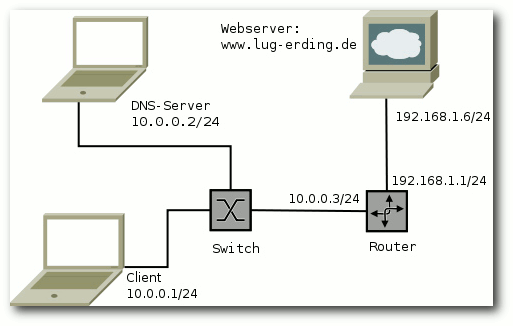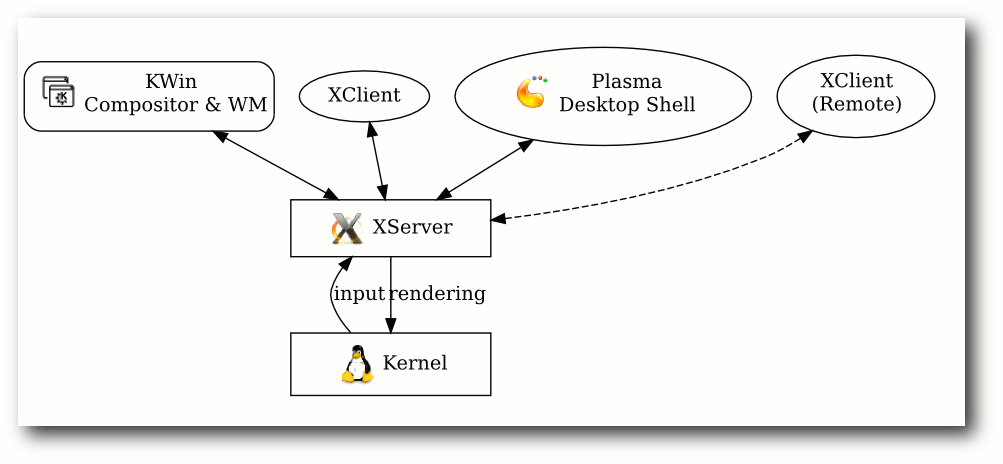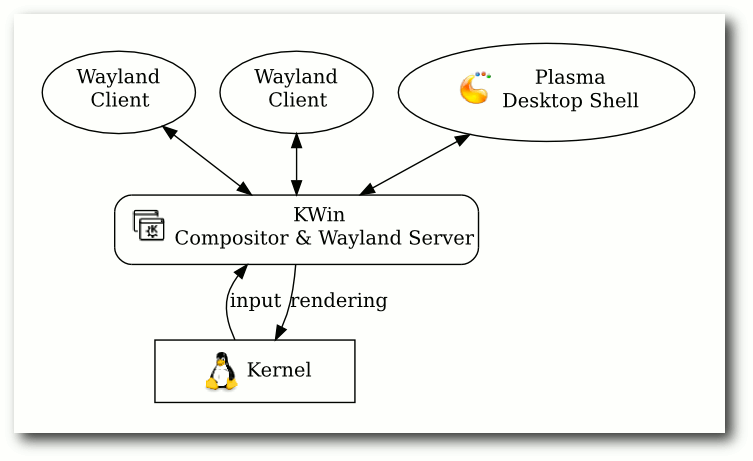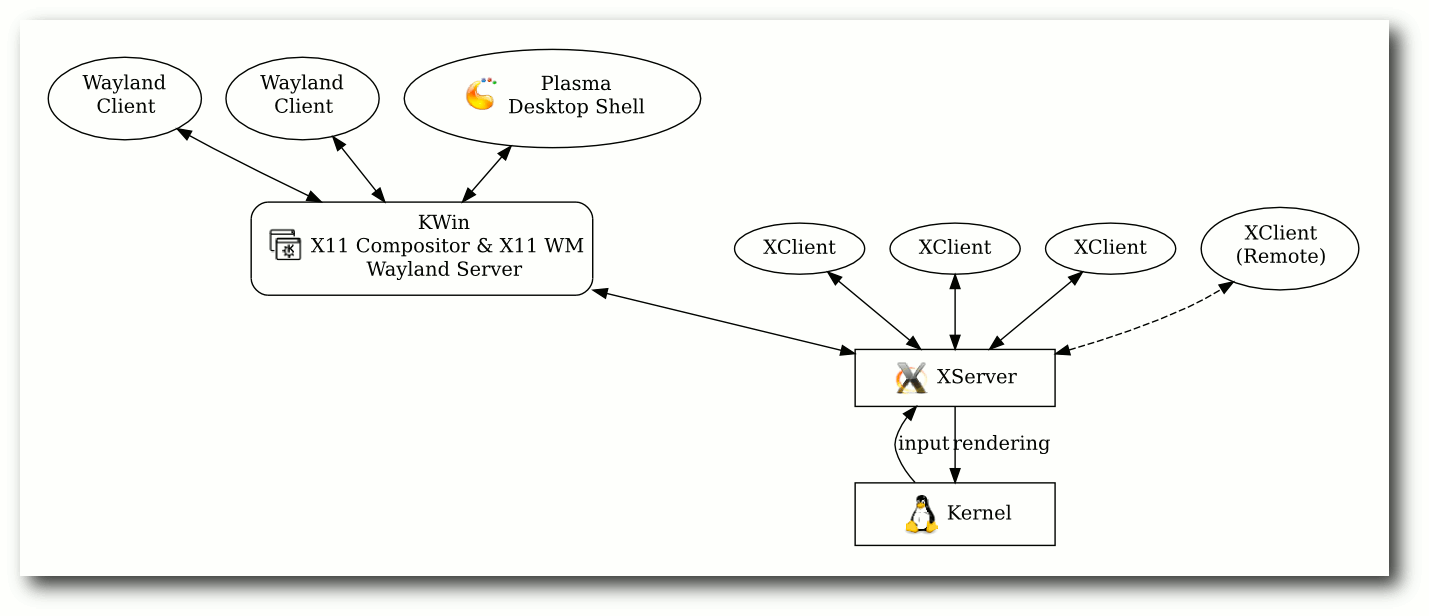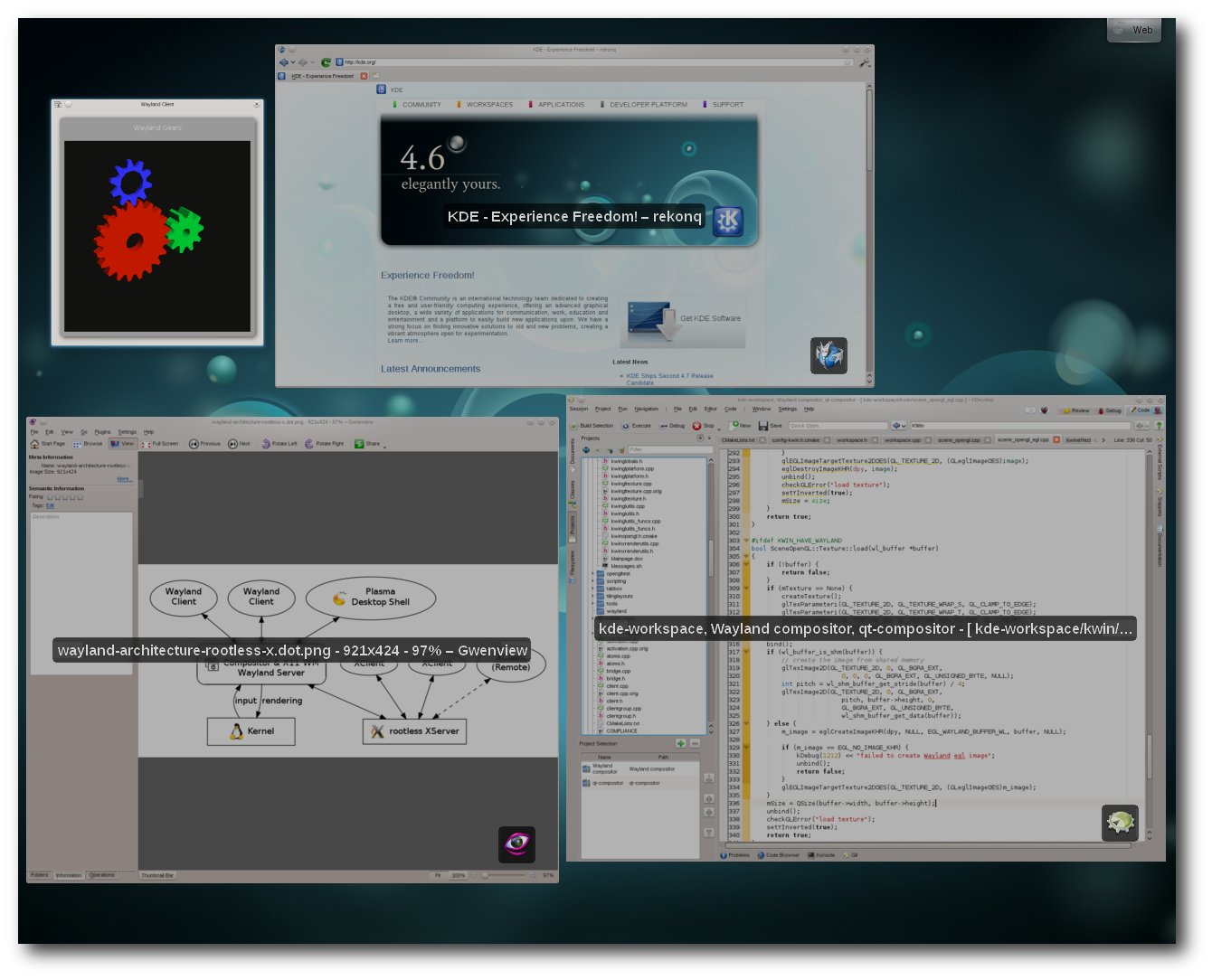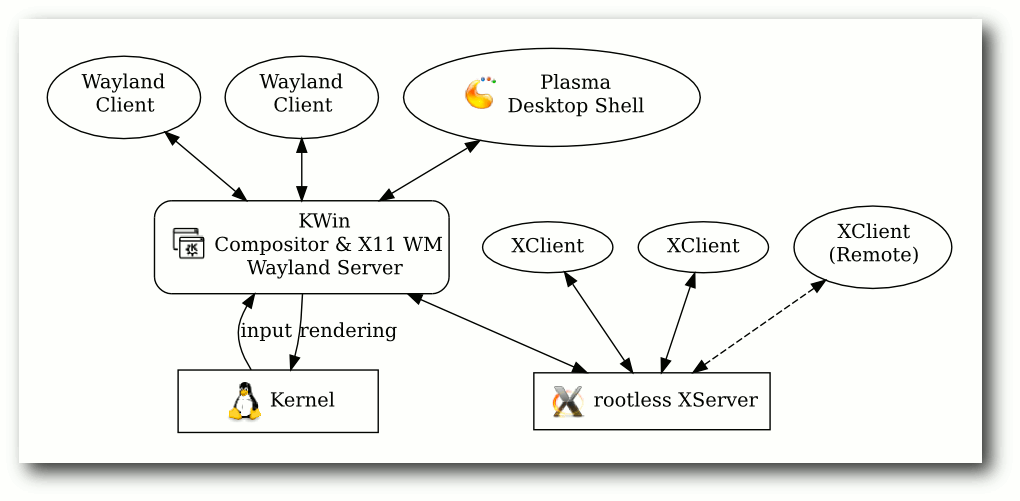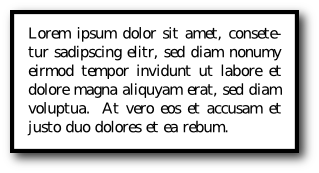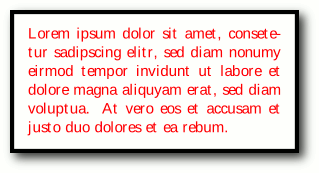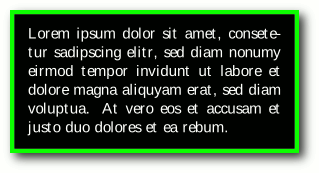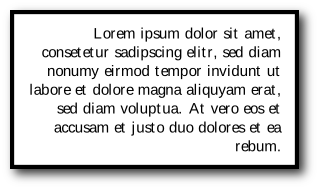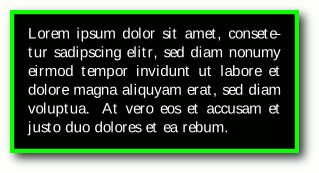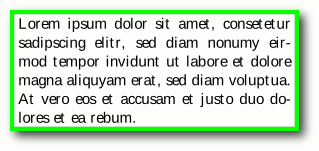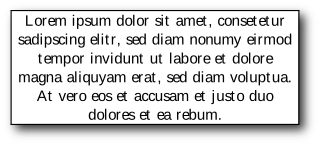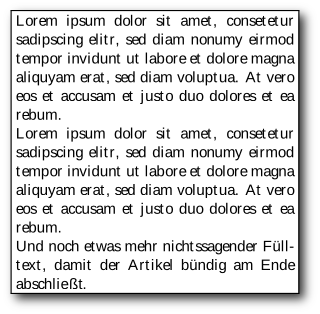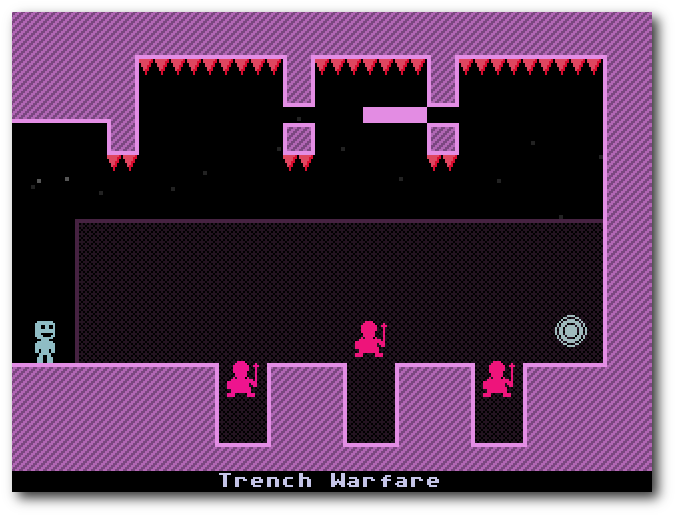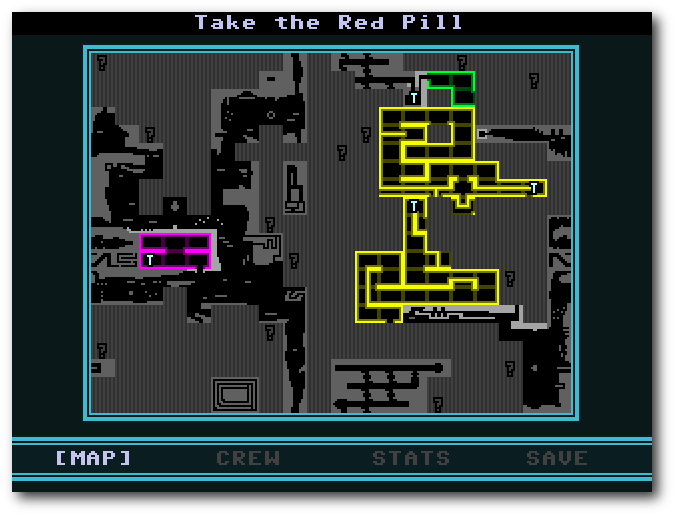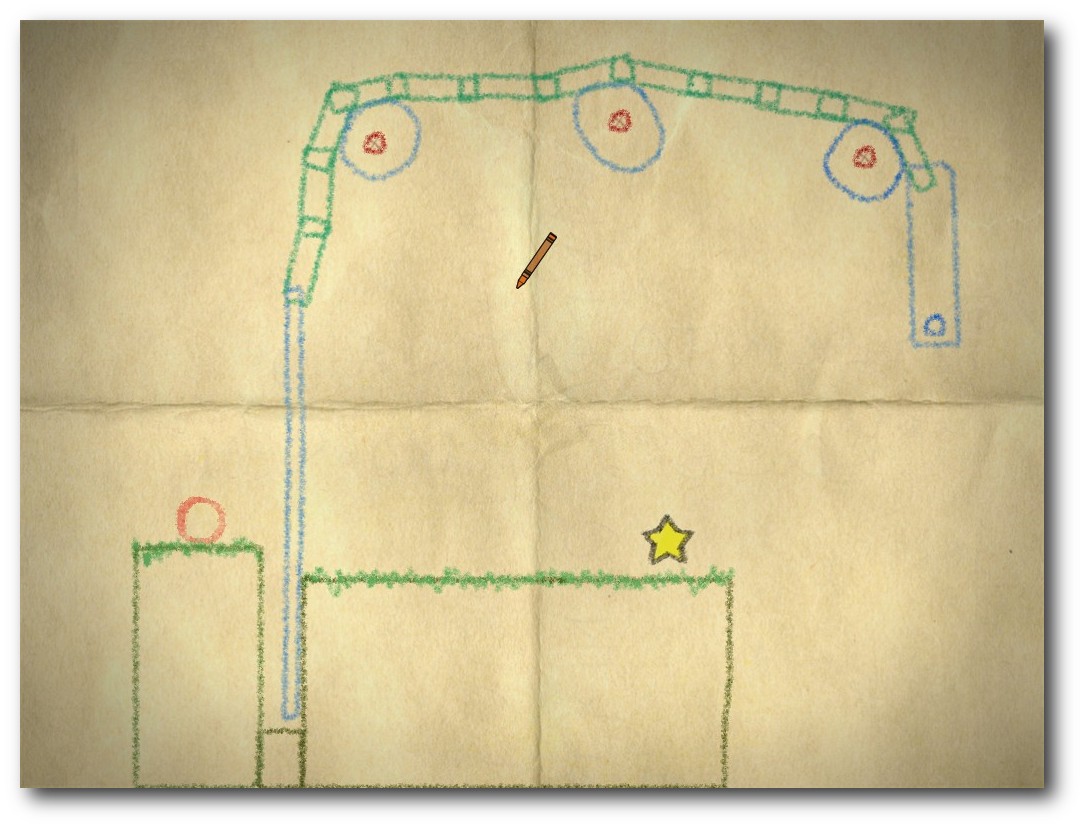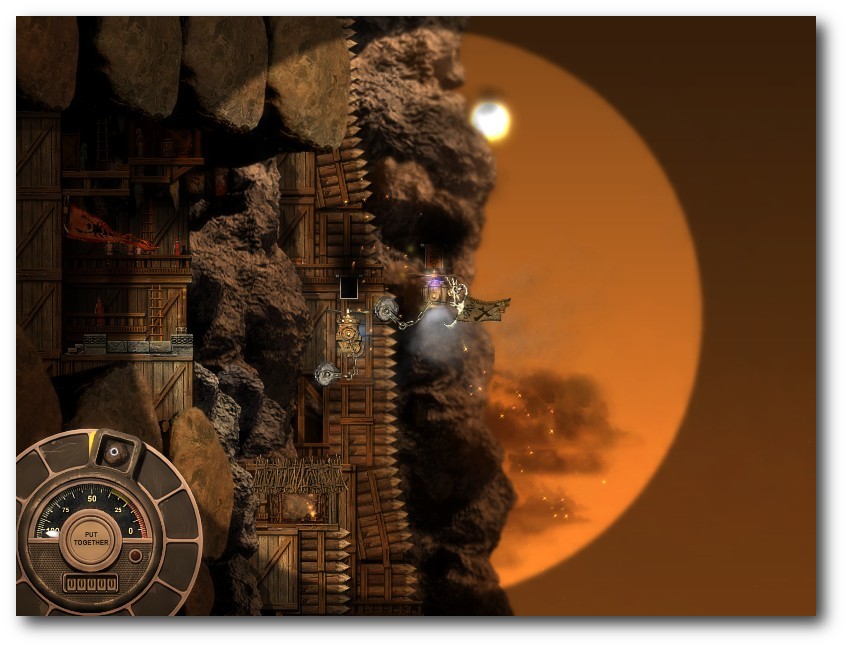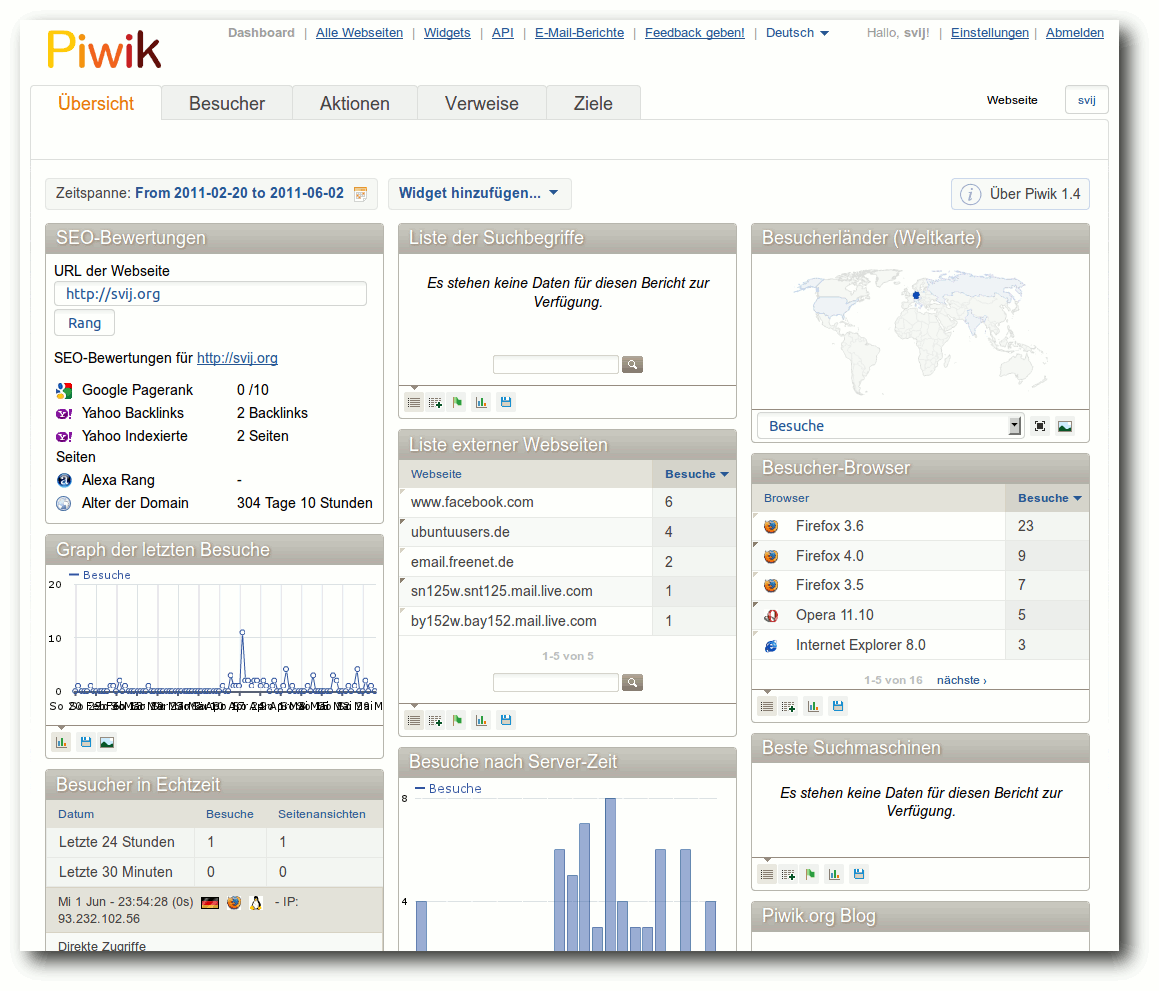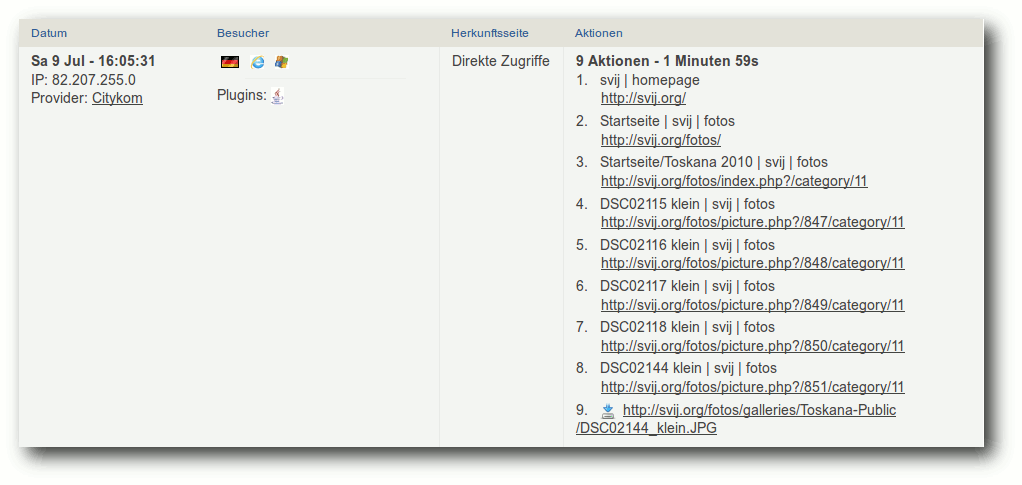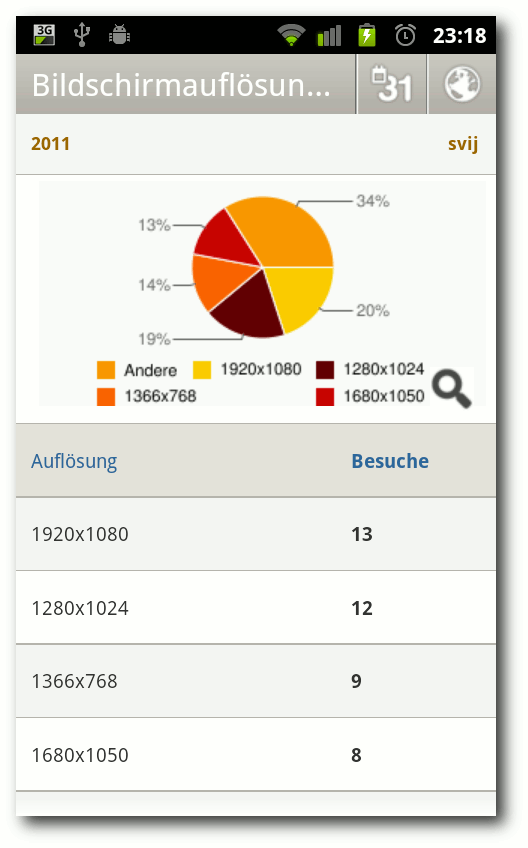Zur Version ohne Bilder
freiesMagazin August 2011 (ISSN 1867-7991)
Topthemen dieser Ausgabe
Webzugriff
Normalerweise muss man nicht im Detail wissen, wie ein Browser auf eine Webseite zugreift. Die genaue Kenntnis der Vorgänge kann jedoch bei der Fehlersuche eine große Hilfe sein. Das Zusammenspiel von DNS, Protokollen und Proxys soll in dem Artikel exemplarisch am Zugriff auf eine Webseite gezeigt werden. Dabei ist hoffentlich alles enthalten: Zerlegen der URL, Finden des Servers, Holen der Seite und anschließende Darstellung. (weiterlesen)
Perl-Tutorium: Teil 1 – Das erste Programm
Nachdem im vorigen Teil die Perl-Geschichte, Perl-Philosophie und Gemeinschaft der Nutzer vorgestellt wurde, beginnt jetzt die Reise zum ersten eigenen Perl-Programm. Nachdem geprüft ist, ob alle wichtigen Werkzeuge funktionstüchtig und griffbereit verpackt sind, geht es zum ersten Etappenziel: Skalare Variablen und einfache IO. (weiterlesen)
Kurzreview: Humble Indie Bundle 3
Das Humble Indie Bundle hat schon eine gewisse Tradition, wurde die erste Version bereits im Mai 2010 veröffentlicht. Teil des Bundles sind Spiele, die von verschiedenen Independent-Studios entwickelt wurden und auf allen großen Plattformen Linux, Mac OS X und Windows laufen. Ende Juli wurde die dritte Ausgabe veröffentlicht, auf deren Inhalt in dem Artikel ein kleiner Blick geworfen werden soll. (weiterlesen)
Zum Index
Linux allgemein
Webzugriff
Compositing nach X11 – KDE Plasma auf dem Weg nach Wayland
Der Juli im Kernelrückblick
Anleitungen
Perl-Tutorium: Teil 1 – das erste Programm
Variable Argumente in LaTeX nutzen
Software
Kurzreview: Humble Indie Bundle 3
Freie Webanalytik mit Piwik
Community
Rezension: LPI 301
Magazin
Editorial
Veranstaltungen
Vorschau
Konventionen
Impressum
Zum Index
Sommerloch?
Nein, die eigentlich an Nachrichten arme Zeit des Jahres geht spurenlos an freiesMagazin vorüber –
und so haben wir auch diesen Monat wieder den einen oder anderen spannenden
Artikel in petto. Darüber hinaus nutzen wir an dieser Stelle die Möglichkeit,
um in eigener Sache um etwas Aufmerksamkeit zu bitten.
Layouter gesucht
Wie schon im
Juli [1]
angekündigt, sucht freiesMagazin wieder nach neuem Teamnachwuchs.
In der Zwischenzeit haben sich auch die ersten neuen Mitstreiter eingefunden.
Darüber freuen wir uns sehr. Allerdings suchen wir nach wie vor noch Nachwuchs für
das Layout in unserem Magazin.
Sollten Sie, liebe Leser, Interesse, Zeit und Lust mitbringen,
um freiesMagazin kreativ mitzugestalten und den Artikeln das
richtige Layout zu verpassen – dann können Sie sich bei uns austoben.
Als Werkzeug der Wahl kommt für das
Layout das Textsatzsystem
LaTeX [2] zum
Einsatz, sodass etwas Wissen auf diesem Gebiet sicherlich nicht
schaden kann. Keine Bange, das Magazin ist aber so gehalten, dass sehr viel mit Makros gearbeitet
wird. Aus diesem Grund sind auch nicht zwingend LaTeX-Profis gefordert, um das Magazin zu
setzen. Wenn jemand Interesse hat, sich auf diesem Gebiet
einzuarbeiten, helfen wir gerne weiter.
Daneben wäre Wissen im Umgang mit dem Versionskontrollsystem
Subversion (SVN) gut, ist aber nicht zwingend erforderlich. Die
wenigen SVN-Befehle, die dazu benötigt werden, sind schnell erlernt –
auch Dank einer hervorragenden
Dokumentation [3]. Zusätzlich stehen in den
meisten Linux-Distributionen und Desktopumgebungen auch grafische
Oberflächen für die Verwaltung bereit, sodass man nicht zwingend die
Konsole bedienen muss – auch wenn es darüber manchmal schneller geht.
Falls Sie also Lust und Interesse haben, an der Gestaltung von freiesMagazin
mitzuwirken, dann schreiben Sie sich doch einfach über den üblichen
Weg an  . Auf Ihr Engagement freuen wir uns!
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
. Auf Ihr Engagement freuen wir uns!
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/20110725-freiesmagazin-sucht-unterstuetzung
[2] http://www.latex-project.org
[3] http://svnbook.red-bean.com
Das Editorial kommentieren
Zum Index
von Dirk Geschke
Normalerweise muss man nicht im Detail wissen, wie ein Browser auf eine
Webseite zugreift. Die genaue Kenntnis der Vorgänge kann jedoch bei der
Fehlersuche eine große Hilfe sein.
Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Webzugriff“ erschien erstmals bei
Pro-Linux [1].
Einleitung
Das Zusammenspiel von DNS, Protokollen und Proxys soll hier exemplarisch am
Zugriff auf eine Webseite gezeigt werden. Dabei ist hoffentlich alles
enthalten: Zerlegen der URL, Finden des Servers, Holen der Seite und
anschließende Darstellung.
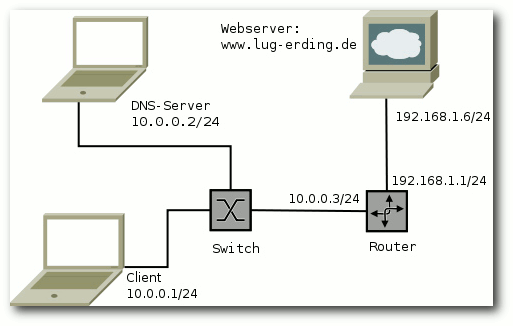
Der verwendete Testaufbau.
Zerlegen der URL
Der erste Schritt besteht in der Analyse der URL. So wird diese in die drei
wichtigen Bestandteile Protokoll, Servername und Pfad auf dem Zielsystem
zerlegt. Beim Protokoll wird gewöhnlich HTTP verwendet. Wird kein Port
angegeben, so ist es der www-Port oder auch der http-Port. Das ist ein
Alias, wie in /etc/services definiert:
www 80/tcp http # WorldWideWeb HTTP
www 80/udp # HyperText
# Transfer Protocol
Definiert sind die Services in der Regel immer für beide Protokolle, also
TCP und UDP. Nur wird wohl keiner jemals UDP für HTTP verwenden.
Neben HTTP wird oft noch HTTP over SSL/TLS verwendet, das wird durch https
angegeben. Dabei wird zwischen dem Transportprotokoll TCP und HTTP noch eine
Verschlüsselungsschicht eingebaut. Da gibt es oft noch FTP, hier wird ganz
normal Port 21 verwendet. Aber auch der Zugriff auf lokale Dateien ist mit
file möglich.
Nach dem Protokoll folgt ein Doppelpunkt und zwei Slashes ://. Bis zum
nächsten Slash folgt dann der Servername, gefolgt vom Pfad auf dem
Zielsystem. Also bei
http://www.lug-erding.de/index.html
ist HTTP das Protokoll, www.lug-erding.de der Servername und index.html der
Pfad zu den Daten auf dem Zielsystem. Gewöhnlich kann index.html weggelassen
werden, dann besteht der Pfad nur aus einem Schrägstrich (/). Der Webserver liefert dann
in aller Regel die Datei index.html aus, oder eine Lokalisierung wie z. B.
index.html.de, falls der Browser die deutsche Sprache bevorzugt.
Wer sich schon einmal gewundert hat, warum der Browser beim Zugriff auf
lokale Dateien drei Slashes in die URL einbaut, hat nun die Antwort: Der
Servername ist leer. Anderenfalls würde er den ersten Pfadteil als
Servernamen interpretieren. Das ergibt bei file natürlich keinen Sinn.
Die URL für den lokalen Dateizugriff könnte also so aussehen:
file:///home/geschke/WEB/index.html
Auch die Protokollnamen, TCP oder UDP, also das nächst höhere Protokoll nach
IP, kann in die entsprechenden Zahlenwerte per /etc/protocols aufgelöst
werden:
tcp 6 TCP # transmission
# control protocol
udp 17 UDP # user datagram
# protocol
TCP ist also das IP-Protokoll 6, UDP hat die Nummer 17. Es ist auch später
entstanden und deutlich einfacher als TCP.
Proxy finden
Ein Browser kann natürlich versuchen, die Seite direkt vom Server zu laden,
es ist aber auch möglich, die Seite über einen (Caching-)Webproxy zu holen.
Das kann den Vorteil haben, dass Daten dort im Cache liegen oder auch
einfach nur verschiedene Wege zu den Servern hier zentral gepflegt werden
können. Auch besteht hier die Möglichkeit, zentral den Zugriff zu
reglementieren.
Wenn der Browser für den Gebrauch eines Proxys konfiguriert ist, so muss er
auch wissen, welchen Proxy er wann verwenden soll. Da gibt es mehrere
Möglichkeiten:
- keinen Proxy verwenden
- manuelle Proxy-Konfiguration, also Angabe von der Adresse und Port
- automatische Proxy-Konfiguration via URL, PAC-Datei (Proxy Auto-Config)
- Proxy-Einstellungen des Systems, Environment-Variablen wie
http_proxy, ftp_proxy oder https_proxy
- Proxy-Einstellungen über das Netzwerk automatisch erkennen, wpad.dat
Bei der PAC-Datei und wpad.dat wird ein kleines JavaScript-Programm geladen, über
dieses können verschiedene Proxys je nach Art der URL verwendet werden. Bei
der manuellen Konfiguration kann man nur einen Proxy angeben, es besteht
aber die Möglichkeit, dass man Ausnahmen definiert. Diese werden dann direkt
vom Server bezogen und nicht via Proxy.
Die via Netzwerk automatisch erkannten Proxy-Einstellungen können über
vielfache Wege ermittelt werden, das kann das Suchen nach einem Webserver in
der eigenen Domain oder via DHCP oder DNS bedeuten. Genauer kann man es bei
Wikipedia [2] nachlesen.
Hier wird aber auch mitunter der nächste Schritt schon relevant: Die
Namensauflösung. Gerade wenn Namen und Ausnahmen für IP-Adressen verwendet
werden oder die PAC-Datei den zuständigen Proxy auf Basis von IP-Adressen
bestimmen will, so wird auch eine Namensauflösung benötigt. Hier wird DNS
notwendig. Ein Vorteil eines Proxys ist, dass man den DNS leichter konfigurieren
kann.
Sollte man also beim Surfen immer eine Verzögerung von 5-10 Sekunden bei
Erstzugriffen merken, dann könnte es an der fehlerhaften Namensauflösung
liegen. Das ist der typische Zeitraum, wann der Resolver aufgibt und der
Browser einfach alles über den definierten Default-Proxy abwickelt.
Namensauflösung
Wird die Namensauflösung nicht über den Proxy geregelt oder der Proxy wird
mit Namen statt IP-Adresse angegeben, so muss der Client, also der eigene
PC, den Namen auflösen. Es gibt mehrere Verfahren, wie man vom Namen zur
IP-Adresse kommen kann. Unter Linux wird das über den hosts-Eintrag in der
Datei /etc/nsswitch.conf geregelt. Bei mir steht da z. B.:
hosts: files dns
In diesem Fall wird der Name zuerst in der lokalen Datei /etc/hosts gesucht.
Steht hier der Name mit einer IP-Adresse, so wird die Suche abgebrochen und
die Adresse verwendet. Damit kann man z. B. die Adressen vom DNS-Server
„überladen“. Für Testzwecke kann das manchmal hilfreich sein, manche
verwenden es auch, um „DoubleClick“ oder „Google-Analytics“ auf 127.0.0.1
umzubiegen. Damit gibt es weniger Werbung bzw. Verfolgung der Webaufrufe.
Kann der Name nicht aufgelöst werden, so erfolgt dann die Abfrage von
DNS-Servern. Hierfür ist die Datei /etc/resolv.conf relevant. In ihr können
bis zu drei Nameserver stehen, es kann auch eine Suchdomain angegeben
werden: Wird der direkte Name nicht gefunden, so werden nach und nach die
angegebenen Domainnamen angefügt und die Suche erneut gestartet, bis eine
IP-Adresse gefunden wird. Anderenfalls wird ein Fehler zurückgeliefert, der
Browser hängt eine Zeit lang und liefert dann eine entsprechende Fehlermeldung.
Ferner könnten in nsswitch.conf auch noch nis/nisplus oder ldap stehen. Das
dürfte heute aber kaum noch einer für die Namensauflösung verwenden. Hat man
den Avahi-Daemon installiert, das ist ein sogenanntes „Zeroconf“-Programm wie
„Rendezvous“ oder „Bonjour“, gibt es noch ein Verfahren mehr. Mit Avahi kann
ein Netzwerk ohne eigenes Zutun, lediglich durch das Verkabeln, aufgebaut
werden. Dem einen oder anderen sind diese Adressen bestimmt schon begegnet,
sie liegen im Bereich 169.254.x.y. Warum man für so etwas ein ganzes Class-B
Netz verschwendet, ist eine andere, gute Frage. Oft wird dieser Daemon durch
die Distribution automatisch mitinstalliert. Dann gibt es noch die Option
mdns, der Eintrag in /etc/nsswitch.conf kann dann so aussehen:
hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4
Diese mdns-Einträge suchen via Multicast nach der IP-Adresse, d. h. sie rufen
in das Netzwerk hinein, ob jemand die IP-Adresse zu dem Namen hat. Meldet
sich hier ein System mit „Nein“, so bricht die Suche ab. Man sollte diesen
ganzen Avahi-Krempel einfach wegwerfen, er stört mehr, als er hilft. Wer von
Netzwerken keine Ahnung hat, der soll einfach die Finger davon lassen und
sich nicht auf die Magie des Betriebssystems verlassen. Aber dummerweise
installieren viele Distributionen das Teil „automagisch“ mit.
Idealerweise sollte man also nur
hosts: files dns
in der Datei /etc/nsswitch.conf haben. Ferner sollte in /etc/hosts immer der
Name localhost enthalten sein:
127.0.0.1 localhost
localhost wird von vielen lokalen Diensten verwendet, der Name sollte also
zum einen immer auflösbar sein und zum anderen auf die Loopback-Adresse
verweisen. Sonst kann man schon seltsame Effekte haben …
Finden des DNS-Servers
Da somit bekannt ist, wie die Namensauflösung erfolgt, kann man davon ausgehen,
dass ein DNS-Server involviert ist und nicht über /etc/hosts-Auflösungen
gesurft wird. Jetzt
kommt der Netzwerkbereich: Wie wird der DNS-Server im
Internet gefunden?
Zur kurzen Erinnerung an TCP/IP: Das Protokoll besteht aus mehreren
unabhängigen Schichten, jede Schicht hat ihr eigenes Protokoll und ihre
eigene Aufgabe. Oft wird dafür auch das OSI-Modell mit seinen sieben
Schichten herangezogen. TCP/IP hält sich aber nur für die ersten Schichten
daran. Relevant sind hier die ersten vier Schichten:
- Physikalische Schicht, z. B. das Netzwerkkabel
- Datenverbindungsschicht, oft Ethernet
- Netzwerkschicht, IP
- Transportschicht, oft TCP oder UDP
Die erste Schicht betrifft nur die Art der Verkabelung oder die Art des
Funks. Relevant wird es mit der zweiten Schicht, das ist in aller Regel
Ethernet. Früher war hier auch noch Token Ring verbreitet, das kommt aber
wohl nur noch selten zum Einsatz. Aber das zeigt den klaren Vorteil des
Schichtenmodells. Die höheren Schichten brauchen nicht zu wissen, ob
Ethernet, WLAN oder gar der Token Ring zum Einsatz kommen. Ebenso brauchen
TCP/UDP nicht zu wissen, ob darunter ein IPv4 oder ein IPv6 verwendet wird.
Das macht es so leicht, hier andere Protokolle zu verwenden.
Für das Weitere wird einfach von Ethernet ausgegangen. IP ist das Protokoll,
das die Internetsysteme miteinander verbindet, das bedeutet hier die Adressierung der
Systeme an Hand der IP-Adressen. Für das lokale Netzwerk, also bis zum
direkt angeschlossenen System oder dem Router/Gateway, ist aber Ethernet
zuständig.
Wie wird denn nun der DNS-Server gefunden? Dazu muss man wissen, wie er
erreicht werden kann. Ein Blick in die Routing-Tabelle offenbart dann, ob
der DNS-Server lokal angeschlossen ist, also im gleichen Subnetz steht, oder
ob er über einen Router erreicht werden muss.
Die logische Adressierung erfolgt über die IP-Adresse. Der Versand zum
nächsten angeschlossenen System, also dem Server oder Router, erfolgt aber
über Ethernet. Erst einmal muss also die Ethernetadresse des Systems
gefunden werden, bekannt ist aber nur eine IP-Adresse.
Das erfolgt nun mit dem Address-Resolution-Protocol. Dabei sendet das
suchende System, also der eigene PC, ein spezielles Ethernetpaket an alle
angeschlossenen Systeme, und fragt nach der Hardware-Adresse zu der
gewünschten IP-Adresse, also entweder der des DNS-Servers, wenn er direkt im
Subnetz steht, oder die des Routers.
Die Hardware-Ethernet-Adresse besteht bei Ethernet aus sechs Bytes, und die
sind für alle Ethernetkarten eindeutig. Sie werden auch MAC-Adresse (Media-Access-Control) genannt.
Die ersten drei Bytes identifizieren dabei den Hersteller der Ethernetkarte,
die restlichen drei sind eine einmalige Adresse bei diesem Hersteller. Diese
Adressen werden in der Regel als Hexadezimalzahlen, getrennt durch
Doppelpunkte dargestellt, z. B.:
00:1a:70:63:16:f5
Die ersten drei Bytes liefern dann über die offizielle
Liste [3] den Hersteller
der Karte:
00-1A-70 (hex) Cisco-Linksys, LLC
Es gibt auch spezielle Adressen, wie z. B. die Broadcast-Adresse. Bei dieser
sind alle Bits gesetzt:
ff:ff:ff:ff:ff:ff
Da die Zieladresse zuerst im Ethernet-Header steht, können alle
Ethernet-Karten leicht erkennen, ob das Paket für sie bestimmt ist, sie
kennen ja die eigene MAC-Adresse. Bei Broadcast-Adressen wissen die Karten
dann durch die spezielle Adresse auch gleich, dass sie das Paket
entgegennehmen sollen. Derartige Pakete nimmt also jede direkt
angeschlossene Ethernetkarte an und leitet diese an das Betriebssystem weiter.
Bei einem ARP-Request steht dann in den Nutzdaten, dass das eigene System
die MAC-Adresse zu der angegebenen IP-Adresse sucht. Da alle Systeme diese
sehen, sollte das System antworten, das die IP-Adresse besitzt. Das ist der
ARP-Response. Mit anderen Worten:
- Man hat die IP-Adresse.
- Die Adressierung im LAN-Segement erfolgt über Ethernetadresse.
- Man ruft in die Runde: Wer hat die Ethernetadresse zu der IP-Adresse?
- Das System mit der IP-Adresse antwortet und sendet die MAC-Adresse,
also die Ethernet-Hardware-Adresse mit.
Wer einen Blick auf das Bild oben wirft, der sieht nun, dass die
MAC-Adresse vom DNS-Server mit der IP-Adresse 10.0.0.2 gesucht wird. Das ist in
der Datei lug.pcap [4]
der erste Eintrag:
00:13:77:5b:25:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1
Das ist der Broadcast, zu erkennen an dem Ziel ff:ff:ff:ff:ff:ff. Die erste
Adresse ist die eigene MAC-Adresse für Antworten. Diese Nachricht wird an
alle Ethernetkarten gesendet, die im gleichen Segment stecken. Die Karten
nehmen dieses Paket dann entgegen und reicht es an den Kernel weiter. Dieser
antwortet dann, wenn er die IP-Adresse hat:
00:1e:68:ef:be:63 > 00:13:77:5b:25:ad, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp reply 10.0.0.2 is-at 00:1e:68:ef:be:63
Hier sieht man noch mehr. Im ARP-Request steht neben der gesuchten Adresse
auch die eigene. Damit kann das System, das gesucht wird, sich schon einmal
die IP-Adresse und MAC-Adresse des Anfragenden merken (ARP-Cache), denn es
gibt wohl eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da gleich noch mehr Traffic
kommen wird.
Die Antwort wird auch direkt an die MAC-Adresse des Fragenden gesendet, der
Absender hat die MAC-Adresse des gesuchten Systems.
Übrigens: Bei DHCP wird in der Regel auch erst ein ARP-Request für die
frisch vergebene IP-Adresse vom System selber versendet. Damit wird
getestet, ob sie nicht schon existiert, also jemand diese zum Beispiel von Hand
konfiguriert hatte.
Das war ein kurzer Ausflug in die Sicherungsschicht [5], wer es genauer wissen will,
kann in
diesem Vortrag zu
Netzwerkgrundlagen [6]
noch mehr Infos finden.
DNS-Namensauflösung
Nachdem nun klar ist, wie der DNS-Server oder der Router dahin gefunden
werden, kann das IP-Paket auf die Reise geschickt werden. Im Fall von DNS ist
das in der Regel ein UDP-Paket an
Port 53 des Servers. Hier sind
allerdings zwei zu sehen, einmal eine Anfrage für die IPv4-Adresse und einmal die für
die IPv6-Adresse:
IP (tos 0x0, ttl 64, id 16351, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 63) 10.0.0.1.40105 > 10.0.0.2.53: 30718+ A? www.lug-erding.de. (35)
IP (tos 0x0, ttl 64, id 16352, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 63) 10.0.0.1.40105 > 10.0.0.2.53: 9550+ AAAA? www.lug-erding.de. (35)
Die MAC-Adressen (und Zeiten) wurden weggelassen. Man sieht dafür
diverse Werte aus dem
IP-Header. So wird kein TypeOfService verwendet, das
Feld wird heute auch eher als QoS (Quality of Service) benutzt.
Interessant ist noch die TTL: Diese gibt an, wie lange das IP-Paket
weitergeleitet werden darf. Jeder Router verringert diesen Wert um 1. Landet
ein System bei 0, so wird das Paket verworfen und an den Absender wird ein
ICMP Time Exceeded gesendet, um ihn darüber zu informieren.
Das Programm traceroute verwendet z. B. diese Option, um den Weg der Pakete
zu bestimmen. Dabei wird sukzessive der Wert von 1 hochgezählt. Bei einem
Wert von 1 antwortet der erste Router, bei 2 der zweite, etc. bis man am
Zielsystem angekommen ist. Da die Router die ICMPs mit der eigenen
IP-Adresse senden, kann man so den Weg bestimmen.
Die id ist wohl selbsterklärend, sie spielt in Verbindung mit offset eine Rolle.
Müssen die IP-Pakete unterwegs zerlegt werden, da nur kleinere Bestandteile
weitergeleitet werden können (DSL hat z. B. eine MTU (Maximum Transfer Unit) von 1492, Ethernet
jedoch von 1500), so kann über die id und den offset bestimmt werden, wozu
die Daten gehören.
Aber das DF-Flag verbietet eine Zerlegung in kleinere Pakte: „Don't Fragment.“
Das heißt, wenn
eine Fragmentierung notwendig ist, darf man es auf Grund dieses
Flags nicht tun. Stattdessen wird das Paket verworfen und eine ICMP-Meldung
wird an den Absender geschickt. Diese besagt, dass das Paket verworfen
wurde, da es zu groß war. Gleichzeitig wird noch mitgesendet, was die
maximale Größe ist, die möglich wäre.
Wenn man also per Ethernet an seinen DSL-Router Pakete mit 1500 Bytes Größe
sendet, so zerlegt der Router dieses Paket in zwei: Einmal 1492 Bytes und
einmal 28 Byte, 20 Byte für einen neuen IP-Header plus die fehlenden 8
Bytes. Letzteres wird noch durch Füllbytes auf eine Mindestgröße
aufgeblasen. Der Empfänger muss diese Pakete dann wieder zusammenbasteln.
Bei gesetztem DF-Bit wird das Paket verworfen, der ICMP wird gesendet und
das sendende System erkennt nun: Mehr als 1492 geht nicht. Folglich werden
dann alle Pakete mit einer maximalen Größe von 1492 Bytes versendet, es gibt
keine Fragmentierung und auch nicht zwei statt einem Paket. Das erhöht den
Durchsatz deutlich.
Die Werte danach besagen, dass die nächste Schicht UDP enthält, das ist
laut /etc/protocols der Wert 17:
udp 17 UDP # user datagram protocol
Danach folgen die IP-Adressen und UDP-Ports. Der Client-Port ist in aller
Regel beliebig, der Zielport mit 53 (domain aus /etc/services) fest, also:
- Ursprung
- 10.0.0.1
- Quellport
- 40105
- Ziel
- 10.0.0.2
- Zielport
- 53
Anschließend kommt die Payload, also die eigentlichen Daten, die per UDP
übermittelt werden. Das ist die Frage nach dem A- und AAAA-Record, also der
IPv4- bzw. IPv6-Adresse von www.lug-erding.de. Die IPv6-Adresse existiert
nicht, es gibt aber eine IPv4-Adresse. Die Ausgabe ist wieder
etwas gekürzt:
IP 10.0.0.2.53 > 10.0.0.1.40105: 30718* 1/1/1 A 192.168.1.6 (85)
Und schon ist das Ziel erreicht: Die IP-Adresse des Webservers ist
gefunden. War doch ganz einfach …
Eine Frage dürfte noch aufgetreten sein: Wie bekommt der Nameserver diese
Adresse, wenn er nicht für die Domain zuständig ist? Die Antwort ist
einfach, der Nameserver muss rekursive Namensauflösung zulassen und er
hangelt sich dann beginnend beim Root-Nameserver durch, bis er beim
Nameserver für die Domain angekommen ist. Dort erhält er die korrekte
Antwort und leitet diese weiter. Details dazu kann man im Artikel „DNS und
BIND“ [7] finden.
HTTP-Anfrage senden
Da die IP-Adresse des Servers jetzt bekannt ist, geht es fast analog zur Suche
des Nameservers weiter. Zuerst wird die Routingtabelle analysiert, um
herauszufinden, was der nächste Hop ist, also an welche MAC-Adresse das
IP-Paket gesendet werden soll.
Die Routingtabelle wird bei Unix mit netstat -r ausgegeben, ein -n hilft
dabei, die Namensauflösung zu unterdrücken. Bei Linux kann man auch einfach
das route-Kommando verwenden, es liefert die gleiche Ausgabe.
$ netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 10.0.0.3 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Es gibt hier nur zwei Einträge. Der erste betrifft das eigene Subnetz,
d. h. alles, was im Bereich von 10.0.0.0 bis 10.0.0.255 liegt (der Bereich
wird durch die Netzmaske festgelegt), wird direkt über eth0 zugestellt. D. h.
es wird ein ARP-Request direkt für das Zielsystem gesendet.
Der zweite Eintrag betrifft die Default-Route, d. h. für alle Adressen, für
die es keinen Eintrag gibt, ist dieser zuständig. In unserem Fall ist der
Zielserver 192.168.1.6, d. h. er muss über die Default-Route erreicht werden.
Bei Gateway steht nun der Router, der den Weg zum Ziel (hoffentlich) weiß.
Folglich wird ein ARP-Request gesendet, um die MAC-Adresse zu der IP-Adresse
10.0.0.3 zu finden:
00:13:77:5b:25:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.0.3 tell 10.0.0.1
00:0d:b9:1f:13:7e > 00:13:77:5b:25:ad, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp reply 10.0.0.3 is-at 00:0d:b9:1f:13:7e
Der Rest läuft analog, nur werden die Pakete nun zum Router gesendet.
Der nimmt diese entgegen und sucht das nächste Ziel. Dann werden die
MAC-Adressen ausgetauscht, die TTL wird um eins reduziert und das Paket geht
zum nächsten Router (aka. Hop).
Da HTTP in der Regel via TCP erfolgt, wird ein TCP-Paket gesendet:
00:13:77:5b:25:ad > 00:0d:b9:1f:13:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: S 1287558560:1287558560(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 1064977 0,nop,wscale 7>
Hier sieht man die MAC-Adressen, analog zur DNS-Anfrage. Die
Ziel-MAC-Adresse ist die vom Router. Im IP-Header (oben nicht angezeigt)
steht jetzt statt UDP, dass es sich um TCP handelt. Das kann man auch an dem
S erkennen. Das ist ein SYN-Paket, der Client möchte eine Verbindung zum
Server öffnen und bittet um SYNchronisation. Es folgen eine Sequence-Nummer
und die Window-Größe, d. h. soviele Bytes darf einem der Server senden, bevor
der
Empfang bestätigt werden muss. Ferner gibt es noch ein paar Optionen. Hier
besagen sie, dass SACK, selektives Bestätigen von Paketen, erlaubt ist, es
werden Zeitstempel zur Bestimmung der Laufzeiten verwendet und mit wscale
können größere Windows angegeben werden, als ursprünglich vom Protokoll
erlaubt waren.
MSS gibt die Maximum Segement Size an, also die maximale Größe für die
Payload, die Nutzdaten im TCP. Der IP-Header ist gewöhnlich 20 Bytes groß,
der TCP-Header ebenfalls. Das macht bei Ethernet einen Wert von
1500-20-20=1460. Das ist die maximale Payload, die ein System senden darf,
sie kann sich noch einmal etwas
verringern, wenn die Gegenstelle Optionen
von TCP verwendet, dann wird der TCP-Header größer. Das ist dann aber ein
Problem der Gegenstelle, die das berücksichtigen muss.
Auf das SYN folgt dann diese Antwort:
00:0d:b9:1f:13:7e > 00:13:77:5b:25:ad, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: S 1133845053:1133845053(0) ack 1287558561 win 5792 <mss 1460,sackOK,timestamp 388120 1064977,nop,wscale 2>
Das sieht analog zu Obigem aus. Interessant ist hier zu sehen, dass als
Absender wieder die MAC-Adresse des Routers auftaucht, obwohl die Antwort ja
vom Webserver stammt. Der Server sendet seinerseit auch ein SYN, er will die
Verbindung in Rückrichtung auch öffnen. Gleichzeitig sendet er auch ein ACK
mit, damit bestätigt (ACKnowledge) er den Verbindungswunsch.
Die ACK-Nummer ist dabei die Sequenznummer plus eins vom Client. Danach
kommen noch die TCP-Optionen vom Server. Dieser verwendet ebenfalls
Zeitstempel. Hier sieht man nun zusätzlich den Zeitstempel des Clients, d. h.
in der Antwort steckt die Uhrzeit, die der Client versendet hat. Darüber
kann nun leicht die Laufzeit bestimmt werden, man muss sich also keine
Gedanken darüber machen, ob die Zeiten synchron sind oder nicht. Es zählt
immer nur die eigene Uhr! Um genau zu sein, braucht die Uhrzeit auch nicht
genau sein, es zählt nur die Zeit, bis man diesen Wert wiedersieht.
Was hat es nun mit den Sequenz- und Acknummern auf sich? Ganz einfach,
darüber wird geklärt, wo die Daten einzuordnen sind. Im Internet ist es zum
Beispiel nicht gewährleistet, dass die Pakete in der richtigen Reihenfolge
oder nur einmal aufschlagen.
Der Trick ist nun, dass die Sequenznummer anzeigt, wo im Datenpaket die
folgenden Bytes liegen, es ist der Startwert. Die Acknowledge-Nummer gibt
wiederum an, welche Daten man von der Gegenstelle erhalten hat. Dabei zeigt
die ACK-Nummer auf das erste Byte, das noch fehlt, also die Seq-Nr. aus dem
SYN-Paket plus die bereits empfangenen Daten plus eins.
tcpdump ist so freundlich und zieht diese Startzahlen bei der Darstellung
gleich ab, dann braucht man selber nicht mehr rechnen und weiß, wieviele
Bytes angekommen sind.
Das dritte Paket sieht, etwas gekürzt, so aus:
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 1064978 388120>
Hier bedeutet ack 1, dass noch gar keine Bytes empfangen wurden. Das ist
klar, in den SYN-Paketen sind auch keine Daten enthalten, das sind nur
IP-Pakete mit TCP-Header.
Ab dieser Stelle ist der sogenannte TCP-Handshake abgeschlossen, diese
Verbindung ist nun aktiv. Um es zu wiederholen:
- Client sendet SYN
- Server antwortet mit SYN und ACK (für das SYN des Clients)
- Client antwortet mit ACK (für das SYN des Servers)
Jetzt steht die TCP-Verbindung, es sind aber noch keine Nutzdaten übertragen
worden. Das folgt im vierten Paket, hier fließen dann tatsächlich Daten:
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: P 1:176(175) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 1064978 388120>
Hier sieht man, dass 175 Bytes übermittelt wurden. Man sieht aber auch noch
mehr, ein Push-Flag. Das ist die Aufforderung an die Gegenstelle, dass die
Daten nicht mehr gesammelt werden sollen. Der Kernel reicht diese daraufhin
an die Anwendung weiter.
Man kann es sich jetzt denken: In dem Paket ist der vollständige
HTTP-Request enthalten. Mehr Daten will der Client jetzt noch nicht senden,
nun ist erst einmal der Server an der Reihe. Schaut man sich das Paket
genauer an (Option -X bei tcpdump), so sieht man den HTTP-Request im TCP-Dump:
21:31:00.912680 IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: P 1:176(175) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 1064978 388120>
0x0000: 4500 00e3 d5b3 4000 4006 98b2 0a00 0001 E.....@.@.......
0x0010: c0a8 0106 b929 0050 4cbe 95a1 4395 1a3e .....).PL...C..>
0x0020: 8018 002e cc84 0000 0101 080a 0010 4012 ..............@.
0x0030: 0005 ec18 4745 5420 2f20 4854 5450 2f31 ....GET./.HTTP/1
0x0040: 2e31 0d0a 436f 6e6e 6563 7469 6f6e 3a20 .1..Connection:.
0x0050: 636c 6f73 650d 0a41 6363 6570 742d 4368 close..Accept-Ch
0x0060: 6172 7365 743a 2075 7466 2d38 2c2a 3b71 arset:.utf-8,*;q
0x0070: 3d30 2e38 0d0a 4163 6365 7074 2d45 6e63 =0.8..Accept-Enc
0x0080: 6f64 696e 673a 2067 7a69 700d 0a48 6f73 oding:.gzip..Hos
0x0090: 743a 2077 7777 2e6c 7567 2d65 7264 696e t:.www.lug-erdin
0x00a0: 672e 6465 0d0a 5265 6665 7265 723a 2068 g.de..Referer:.h
0x00b0: 7474 703a 2f2f 7777 772e 6c75 672d 6572 ttp://www.lug-er
0x00c0: 6469 6e67 2e64 652f 0d0a 5573 6572 2d41 ding.de/..User-A
0x00d0: 6765 6e74 3a20 4469 6c6c 6f2f 322e 320d gent:.Dillo/2.2.
0x00e0: 0a0d 0a ...
Links ist die Byte-Nummer des Zeilenanfangs, dann kommen die Rohdaten des
IP-Paketes in Hexadezimaldarstellung und rechts findet man die
ASCII-Darstellung der Zeichen. Punkte sind dabei nicht darstellbare Zeichen
oder auch Leerzeichen. Zieht man den IP-Header und den TCP-Header ab, dann
bekommt man:
GET / HTTP/1.1
Connection: close
Accept-Charset: utf-8,*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip
Host: www.lug-erding.de
Referer: http://www.lug-erding.de/
User-Agent: Dillo/2.2
Das ist also der vollständige HTTP-Request. Wer Details dazu braucht, der wird
im Artikel „HTTP und Squid“ [8]
mehr finden.
Was man im obigen Dump auch gut sieht, ist die Sequenz 0d0a0d0a ganz am
Ende. Schaut man in der ASCII-Tabelle nach (Tipp: man ascii), so findet man
dort:
012 10 0A LF '\n' (new line)
015 13 0D CR '\r' (carriage ret)
Der erste Wert ist oktal, also Basis 8, dann dezimal gefolgt von
hexadezimal. Danach folgt das Zeichen: Zeilenvorlauf und Zeilenrücklauf, so
wie es bei der guten alten Schreibmaschine war. Das ganze zweimal, einmal
für den Zeilenabschluss und einmal für eine Leerzeile. Es wird hier also
nicht, wie in Unix üblich, nur ein Newline für den Zeilenabschluss verwendet.
HTTP-Antwort empfangen
Nachdem der Client den Request abgesendet hat (Push-Flag, um dies dem
anderen System anzudeuten), ist der Server an der Reihe. Zuerst wird der
HTTP-Request bestätigt:
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . ack 176 win 1716 <nop,nop,timestamp 388120 1064978>
Das heißt der Kernel reicht nun die Daten (den HTTP-Request) an den Webserver
weiter. Dieser analysiert ihn und antwortet darauf (die
TCP-Optionen wurden weggelassen, da sie hier keine wichtigen
Informationen mehr enthalten):
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1:1449(1448) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1449 win 69
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1449:2897(1448) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 2897 win 91
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 2897:4345(1448) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 4345 win 114
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: FP 4345:4604(259) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47402 > 192.168.1.6.80: S 1285270109:1285270109(0) win 5840
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47402: S 1135847585:1135847585(0) ack 1285270110 win 5792
IP 10.0.0.1.47402 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46
IP 10.0.0.1.47403 > 192.168.1.6.80: S 1290686861:1290686861(0) win 5840
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47403: S 1138145597:1138145597(0) ack 1290686862 win 5792
IP 10.0.0.1.47403 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: F 176:176(0) ack 4605 win 137
IP 10.0.0.1.47402 > 192.168.1.6.80: P 1:188(187) ack 1 win 46
...
Hier kann man noch etwas beobachten: Erst werden die Daten gesendet und auch
bestätigt. Dann schließt der Webserver die Verbindung mit einem FP, aber der
Client macht gleich darauf noch zwei Verbindungen auf, einmal mit dem
Source-Port 47402 und einmal mit 47403.
Warum macht er das? Ganz einfach: Nachdem die index.html-Datei übertragen
worden war, hat der Client diese analysiert und gesehen, dass da noch mehr
Elemente nachgeladen werden müssen. Dafür öffnet er dann mehrere
Verbindungen, um die Daten parallel zu laden. Das könnten auch andere Server
sein, dann wäre es vermutlich deutlich schneller.
Mit tcpdump kann man aber auch gezielt eine Verbindung heraussuchen, z. B.
durch Angabe des Source-Ports:
$ tcpdump -n -r lug.pcap port 47401
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: S 1287558560:1287558560(0) win 5840
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: S 1133845053:1133845053(0) ack 1287558561 win 5792
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: P 1:176(175) ack 1 win 46
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . ack 176 win 1716
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1:1449(1448) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1449 win 69
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1449:2897(1448) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 2897 win 91
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 2897:4345(1448) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 4345 win 114
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: FP 4345:4604(259) ack 176 win 1716
IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: F 176:176(0) ack 4605 win 137
IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . ack 177 win 1716
Jetzt sieht man auch, wie die Verbindung abgebaut wird. Es können zwischen
drei und vier Pakete sein:
- FIN + ACK, hier noch mit Push-Flag
- ACK des FINs -> half-closed Verbindung
- FIN + ACK von der Gegenstelle
- ACK, letztes FIN bestätigen, Verbindung ist zu
Im obigen Fall erfolgt 2. und 3. in einem Paket. Es ist aber auch möglich,
eine Verbindung halboffen zu halten, dann kann nur noch eine Seite senden
Die Payload enthält den HTTP-Header der Antwort des Servers:
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Last-Modified: Thu, 30 Dec 2010 15:09:38 GMT
ETag: "1886677020"
Content-Type: text/html
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4321
Connection: close
Date: Thu, 01 Jan 1970 01:09:41 GMT
Server: lighttpd/1.4.28
Danach folgt eine Leerzeile und Binärdaten. Der Server hat den Inhalt der
Webseite mit gzip (Content-Encoding: gzip) gesendet. Wer sich an den Request
erinnert, da stand u. a.:
Accept-Encoding: gzip
Daher wurde hier alles gepackt verschickt. Dabei ginge es auch anders, das
deutet der Server mit
Vary: Accept-Encoding
an. Er könnte die Daten auch anders ausliefern, vermutlich nicht-gepackt.
Aus diesem Grund wurde auch noch
lug2.pcap [9] erstellt,
da sieht man dann die Daten vom Server in der Antwort ungepackt.
Wer sich über das Datum wundert: Der 1.1.1970 ist der Start der Unix-Zeit,
er entspricht 0 Sekunden. Von dieser Zeit an wird die Zeit in Sekunden
gezählt. Der Webserver hier war aber mein DockStar. Scheinbar kann der sich
die Uhrzeit nicht merken und fängt dadurch beim Einschalten bei 0, also beim
1.1.1970 an.
Weiteres Vorgehen im Browser
Der Browser analysiert die erhaltenen Daten. Dabei gibt der Content-Type
Auskunft darüber, um was für Daten es sich handelt. Bei reinen HTML-Dateien
steht da z. B.:
Content-Type: text/html
Der Browser kann diese Daten direkt darstellen. Dazu analysiert er aber erst
die Datei, ob da noch weitere Elemente vorliegen, so wie verwendete
CSS-Dateien, eingebettete Links, Bilder, etc. Wenn alle Elemente vorliegen,
fängt der Browser an zu rendern, d. h. er versucht die Elemente in der
angegebenen Weise zu arrangieren, so dass sie darstellbar werden. Da hat
dann z. B. die aktuelle Browsergröße einen Einfluss. Hier wird auch oft die
meiste Zeit beim Surfen gewartet: Oft hilft deswegen auch keine schnellere
Leitung.
Was passiert, wenn es sich um nicht-HTML-Dateien handelt? Dann schaut der
Browser anhand des Content-Types nach, ob er ein Plug-in zur Darstellung hat.
(about:plugins in der URL-Zeile des Firefox gibt hier Auskunft oder auch
„Bearbeiten -> Einstellungen -> Anwendungen“.)
Ist das nicht der Fall, so wird in /etc/mailcap oder ~/.mailcap nachgesehen,
ob hier steht, welches Programm die Daten anzeigen kann. Firefox fragt dann
aber in aller Regel nach, ob er das Programm auch verwenden soll, eine
Alternative dazu, oder ob die Daten nur gespeichert werden sollen.
In mailcap steht z. B.:
application/pdf; /usr/bin/gv '%s' ...
D. h. bei PDF-Dateien würde er hier das Programm gv starten, um die Daten
anzeigen zu lassen. Oft gibt es aber mehrere Varianten, z. B. auch xpdf oder
Evince. Normalerweise wird die erste genommen, manche Programme schlagen das
auch vor, bieten aber die Option, ein anderes auszuwählen.
Fehlersuche
Das praktische Vorgehen ist meistens ein Abwarten der Fehlermeldung im
Browser. Hat man eine, so ist der Rest schon fast selbsterklärend. Oft sind
es DNS-Probleme, d. h. der Name konnte nicht aufgelöst werden. Gelegentlich
gibt es auch Routing-Probleme: Der Zielserver ist über das Routing nicht zu
erreichen.
DNS kann am einfachsten mit dig getestet werden, z. B.:
$ dig www.lug-erding.de
Führt dies nicht zur IP-Adresse, so sollte man einmal versuchen, den ganzen
DNS-Baum durchzuhangeln. D. h. man befragt die Root-Nameserver für den
zuständigen de-Nameserver, den befragt man für den für lug-erding.de
zuständigen Nameserver und diesen wiederum nach der IP-Adresse für den Namen
www.lug-erding.de. Einzelne Nameserver können bei dig mit dem @-Zeichen
angegeben werden, z. B.:
$ dig www.lug-erding.de @ns9.nameserverservice.de
oder gleich mit der IP-Adresse:
$ dig www.lug-eding.de @85.25.128.54
Das Durchhangeln kann dig aber mit der Option +trace selbständig machen:
$ dig +trace www.lug-erding.de
Wenn die IP-Adresse bekannt ist, kann man z. B. mit telnet testen, ob der
Server einen offenen Port hat und reagiert, z. B.:
$ telnet www.lug-erding.de 80
Gibt es die Meldung
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
so ist der Webserver nicht am Laufen. Da kann man dann wenig machen, es sei
denn, es ist der eigene Webserver …
Um festzustellen, ob es sich um ein Routing-Problem handelt, bietet sich das
Programm traceroute an. Per Default sendet das Programm UDP-Pakete an das
Zielsystem. Normalerweise sind es drei Pakete an die fortlaufenden Ports ab
33434.
Wie funktioniert das Auffinden der Router zum Ziel? – Ganz einfach über das TTL-Feld im IP-Header: Jeder Router reduziert diesen Wert um eins,
bis das Paket am Ziel ist oder der Wert Null erreicht wird. Das soll
verhindern, dass Pakete ewig im Kreis laufen. Bei einem Wert von Null
passieren in der Regel zwei Dinge:
- Das Paket wird verworfen.
- Ein ICMP Time Exceeded wird an den Absender des Paketes gesendet, die
Absende-IP-Adresse ist die des Routers, der das ICMP generiert.
traceroute spielt mit dieser TTL. Beim ersten Paket ist
die TTL auf 1 gesetzt. D. h. der erste Router muss das Paket schon verwerfen
und ein ICMP senden. Damit hat man schon den ersten hop. Danach wird die TTL
nach und nach erhöht, bis man am Ziel angekommen ist oder wo auch immer die
Pakete verloren gehen.
Das funktioniert recht gut, allerdings spielen nicht alle Router mit, nicht
jeder generiert ein ICMP Time Exceeded-Paket. Dann werden nur Sterne (*)
statt der Router-IP-Adresse angezeigt.
Für den ersten Test des Routings sollte man die Option -n verwenden. Dadurch
werden die IP-Adressen angezeigt und es wird nicht versucht, den Namen per
DNS zu ermitteln. Hat man einen problematischen Router gefunden, dann hilft
der DNS-Name oft herauszufinden, wo er stehen mag. Eine whois-Abfrage kann
auch den Provider liefern. Ob dieser dann aber überhaupt auf Beschwerden
reagiert, ist eine andere Frage …
traceroute kann statt UDP-Pakete auch ICMP-Pakete, wie sie ping verwendet,
benutzen. Dazu ist die Option -I da. Die lokale Routingtabelle kann unter
Unix einheitlich mit netstat -r ausgelesen werden. Bei Linux geht auch
einfach das route-Kommando. Hilfreich ist auch hier oft die Option -n, sie
schaltet wieder die Namensauflösung ab.
Den ARP-Cache kann man mit arp -a auflisten. Die Einträge werden aber in der
Regel, sofern kein Datenverkehr mit der Adresse besteht, nach 15-45 Sekunden
gelöscht, man muss schon schnell schauen. Auch hier kann die Option -n mit
dem gleichen Effekt verwendet werden.
Wenn alle Stricke reißen, dann kann tcpdump eine gute Wahl sein. Da sind
Fehler aber nur mit geübtem Auge zu erkennen und oft sieht man vor lauter
Wald die Bäume nicht. Während tcpdump sich in der Regel bei den unteren
Protokollen gut auskennt, können die höheren Protokolle mit dem Programm
wireshark gut analysiert werden. Dafür empfiehlt es sich aber, die Daten mit
tcpdump in eine Datei zu schreiben und als normaler Benutzer diese in
wireshark einzulesen.
Der Grund dafür ist einfach: wireshark ist sehr mächtig und analysiert sehr
viele Protokolle. Da ist es eigentlich normal, dass dort noch viele Bugs
enthalten sind, die vielleicht durch speziell konfigurierte Pakete
ausgenutzt werden könnten. Da ist es dann nicht klug, diese live als
Benutzer root analysieren zu lassen. Zeitversetztes Einlesen der Datei in
wireshark als normaler Benutzer entschärft das dann deutlich.
Fazit
Oben wurde gezeigt, was hinter einem einzelnen Mausklick im Browser alles
passiert, welche Prozesse involviert sind – bis hinunter zur Paketebene.
Gewöhnlich verschwendet man daran keinen Gedanken: Es funktioniert ja auch
in der Regel recht gut. Warum sollte man sich also dafür interessieren,
was unter der Haube passiert? Die meisten werden es in der
Regel nicht tun, geschweige denn sich einmal im Detail ansehen, was da
wirklich passiert.
Auf der anderen Seite gibt einem das Verständnis aber ein wenig Sicherheit
im Umgang mit den Internet-Diensten. Dieser Punkt wurde allerdings noch
nicht betrachtet: Sicherheit! Da nun im
Detail bekannt ist, was abläuft, kann man sich auch relativ einfach überlegen, wo
überall etwas schief gehen kann, vor allem, wenn es einer mit Absicht
macht.
Wer aufgepasst hat, der weiß jetzt auch, wie sinnlos Websperren per DNS sein
können: Sie treffen nur diejenigen, die sich nicht auskennen. Sonst nimmt
man einfach einen anderen Nameserver, z. B. den von Google: 8.8.8.8. Wie soll
man dessen Antworten nicht nur filtern, sondern auch noch ändern?
Oder soll mit den DNS-Sperren sämtlicher DNS-Verkehr geblockt werden, außer
zum lokalen Provider? Das dürfte extrem schwer zu rechtfertigen sein. Wobei
die T-Home das durchaus macht(e): Da war zumindest damals eine Abfrage des
Google-Nameservers geblockt.
Warum alles fast immer so einwandfrei läuft, ist recht einfach erklärt: Das
Internet ist in den mehr als 40 Jahren, die es existiert, darin gewachsen.
Aber dennoch können immer wieder Probleme auftauchen, sie sind nur so
selten, dass es einem meist nicht auffällt. Wenn mal eine Webseite nicht
funktioniert, dann braucht man in der Regel nicht lange zu warten, bis das
repariert wird.
Und in vielen Fällen gibt es Redundanzen. So schreibt das DeNIC sogar vor,
dass man wenigstens zwei Nameserver haben muss. Idealerweise sollten die
auch nicht auf dem gleichen System sein, sie sollten nach Möglichkeit auch
in unterschiedlichen Netzsegmenten liegen.
Man kann man mit DNS auch noch so einiges mehr anstellen, so wie es z. B.
Akamai tut: Man kann die Zugriffe auf Webserver beschleunigen. Ein Verfahren
dabei ist, dass Akamai weltweit Webserver für ihre Kunden betreibt und den
Traffic auf den nächstgelegenen Webserver umleitet.
Wie machen die das? Ein Verfahren ist nun leicht zu verstehen,
z. B. das von www.rtl2.de [10]. Die Nameserveranfrage offenbart
es:
www.rtl2.de. 3600 IN CNAME www.rtl2.de.edgesuite.net.
Das ist nicht ungewöhnlich, die Namensauflösung wird auf den rechten Namen
weitergeleitet. Das ist ein Nameserver von Akamai. Dieser sieht nun, woher
der Client kommt. Das dürfte nämlich von der IP-Adresse des ISPs kommen.
Anhand dieser Adresse kann Akamai nun feststellen, in welcher Region der
Anfragende (vermutlich) sitzen wird. Um ihm dann den nächstgelegenen Server,
möglichst der mit der geringsten Load, zuzuordnen, gibt es einen zweiten
CNAME:
www.rtl2.de.edgesuite.net. 21600 IN CNAME a1195.g.akamai.net.
Für diese Namensauflösung muss nun ein Nameserver von Akamai befragt werden,
der in der Nähe liegen sollte. Dieser weiß, welche Webserver die geringste
Last haben, und liefert dessen IP-Adresse aus. Damit diese schnell reagieren
können, ist die TTL des Nameserver-Eintrags recht kurz:
a1195.g.akamai.net. 20 IN A 95.100.249.122
a1195.g.akamai.net. 20 IN A 95.100.249.113
Das sind nur 20 Sekunden, nach dieser Zeit muss die Namensauflösung erneut
angestoßen werden. Dann könnte z. B. die Antwort so aussehen:
a1195.g.akamai.net. 20 IN A 77.67.20.18
a1195.g.akamai.net. 20 IN A 77.67.20.41
Und offenbar muss sich das bei der Performance rechnen: Die zusätzlichen
Namensauflösungen scheinen durch den Standortvorteil gerechtfertigt zu sein,
zumindest ist Akamai gut im Geschäft …
Links
[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1509/webzugriff.html
[2] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Web_Proxy_Autodiscovery_Protocol
[3] http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt
[4] http://www.pro-linux.de/files/webzugriff/lug.pcap
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell#Schicht_2_.E2.80.93_Sicherungsschicht
[6] http://www.lug-erding.de/vortrag/ng.html#ARP
[7] http://www.lug-erding.de/artikel/DNS+BIND.html
[8] http://www.lug-erding.de/artikel/HTTPundSquid.html
[9] http://www.pro-linux.de/files/webzugriff/lug2.pcap
[10] http://www.rtl2.de/
| Autoreninformation |
| Dirk Geschke (Webseite)
ist Gründer der Linux User Group Erding. Im Rahmen von Gesprächen
bei der LUG offenbarten sich einige Verständnislücken über die Funktion von
Netzwerken und auch was bei einem Webzugriff tatsächlich alles passiert.
Aus einem Vortrag zu diesem Thema ist dieser Artikel entstanden.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Martin Gräßlin
Wayland [1] gilt als möglicher Nachfolger der X11
Architektur. Die ersten Projekte, wie z. B. MeeGo, planen Veröffentlichungen mit
Wayland und auch die großen traditionellen Desktopumgebungen planen die
Unterstützung dieser neuen Architektur. In diesem Artikel wird die Transition
auf Wayland am Fallbeispiel der KDE Plasma Workspaces betrachtet. Der Inhalt
dieses Artikels wurde auch am diesjährigen Desktop Summit in Berlin als
Präsentation [2]
vorgestellt.
Die X11 Architektur
In freiesMagazin 03/2011 [3]
wurde bereits die Architektur von X11 beleuchtet und warum es für die Zukunft nur die Lösung
eines X freien Systems geben kann. X11 [4]
ist eine Technologie aus den 80er
Jahren des letzten Jahrhunderts, lange bevor irgend jemand an Anwendungsfälle
wie Compositing [5] gedacht hat.
In einer modernen X11-Architektur, wie sie heute von allen Desktopumgebungen verwendet wird (siehe Skizze rechts), ist die Funktionalität
des X-Servers auf die eines Proxys beschränkt. Der X-Server ist nicht mehr für
das Zeichnen der Fenster zuständig. Dies wird komplett vom Compositor und
Fenstermanager (z. B. KWin) übernommen. In der X11-Architektur kann der
Compositor nicht direkt mit den X-Clients (den Fenstern) sprechen – alle Informationen
werden durch den X-Server geleitet.
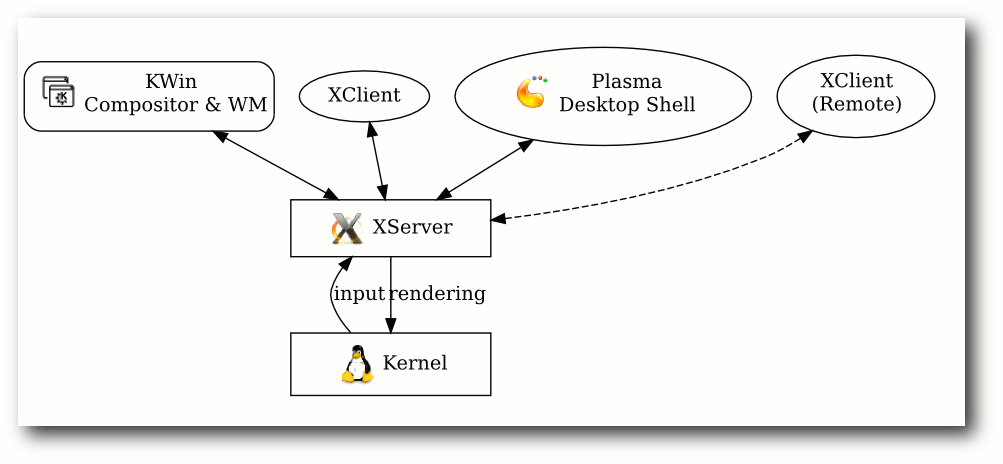
Moderne X11 Architektur: X-Server als Proxy zwischen Compositor und Fenstern.
Diese Architektur schränkt die Möglichkeiten stark ein und erschwert die
korrekte Implementierung. So werden zum Beispiel Maus- und Tastaturereignisse
nicht durch den Compositor geleitet. Diese als „Input Redirection“ bekannte
Funktionalität wäre aber sinnvoll, denn eigentlich entscheidet der Compositor,
welches Fenster die Ereignisse erhalten soll. Insbesondere sind interaktive,
transformierte Umgebungen dadurch nicht möglich. Man denke dabei an so triviale
Anwendungsfälle wie ein Anwendungsstarter in einer Übersicht der virtuellen
Desktops oder einem auf Lagesensor reagierenden Invertieren des Bildes bei einem
Tablet (Beispiel-Video: [6]).
Generell entsteht ein Problem dadurch, dass der X-Server aus historischen
Gründen noch für viele Funktionen verantwortlich ist, die eigentlich in den
Compositor gehören. So pflegt der X-Server eine eigene „Stacking Order“
(Anordnung der Fenster [7]),
obwohl alleine der Compositor über diese entscheidet.
Der Compositor wäre eigentlich dafür verantwortlich,
Richtlinien umzusetzen (z. B. Anordnung der Fenster, welches Fenster ist aktiv),
kann dieses aber nicht, da die Funktion in X implementiert ist und jeder Client
manuell den Zustand ändern kann. Dadurch entsteht ein dauernder Kampf zwischen
Fenstermanager und Fenster, wie das Fenster aussehen soll.
Die Wayland-Architektur
In der Wayland-Architektur ist der Proxy zwischen Anwendungen und Compositor
entfernt. Der Compositor sitzt direkt auf der Hardware und nutzt diese zum Zeichnen
und zum Empfangen von Eingabeereignissen.
Es ist die Aufgabe des Compositors, die Eingabeereignisse an die Wayland-Clients
(Fenster) weiterzuleiten. Die in der alten Architektur fehlende Input Redirection
ist nun ein direkter Bestandteil der Architektur.
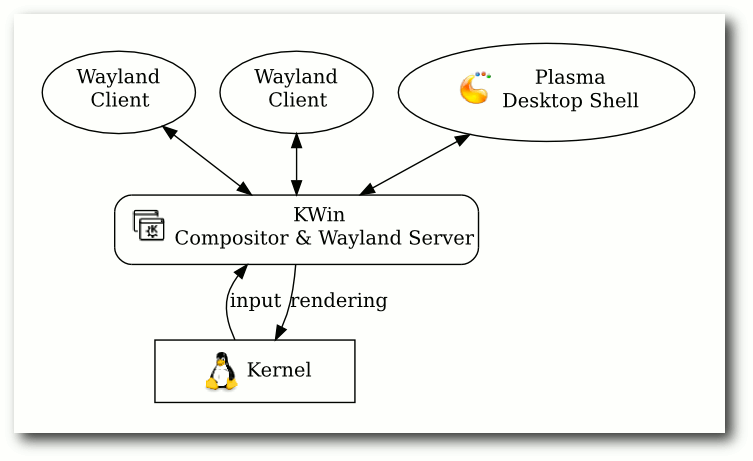
Mit Wayland wandert der Compositor in das Zentrum.
Die Verbindung zwischen Clients und Compositor ist auch denkbar einfach gehalten.
Zur Kommunikation wird ein Unix-Socket verwendet und über diesen Socket werden
Bufferinformationen ausgetauscht. Die Clients zeichnen in einen Buffer und
informieren den Compositor über Änderungen zum vorhergehenden Buffer
(Frame/Bild). Der Compositor wiederum informiert den Client, wenn ein Frame
gezeichnet wurde, sodass Compositor und Clients synchron zeichnen können.
Ansonsten ist die Interaktion zwischen Clients und Compositor (noch) sehr gering.
Es existiert noch kein Fenstermanagement-Protokoll und es ist fraglich, ob es
jemals eines geben wird. Mit Wayland sind die Richtlinien zum Verwalten der
Fenster komplett in den Compositor verlagert, wodurch vieles, was X11
ermöglichte, einfach überflüssig wird. Als Beispiel kann man den Zustand
„minimiert“ verwenden: für den Client ist es eigentlich egal ob er minimiert
ist, die einzige wichtige Information ist, wann er zuletzt gezeichnet wurde, was
er sowieso erhält.
Wayland Entwicklungsstand
Aktuell ist die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten, dass man an einen
produktiven Einsatz auf einem Desktop denken kann. Vieles ist noch nicht
spezifiziert oder noch nicht implementiert. Kaum ein aktuell verfügbares Toolkit
unterstützt bereits Wayland. Die wichtigen Komponenten wie Unterstützung in den
Grafikkartentreibern haben erst mit Mesa 7.11 (Release erfolgte im Juli) Einzug
gehalten. Ohne diese ist der Einsatz unter Wayland noch undenkbar. Unterstützung
in Qt wird ab Version 4.8 verfügbar sein, dies erfordert aber auch, dass
Distributionen Wayland standardmäßig paketieren (was bisher noch nicht der Fall
ist).
Im aktuellen Entwicklungsstand muss eine Anwendung über
OpenGL ES 2.0 [8] zeichnen; „normales“
OpenGL [9] ist noch nicht vorgesehen, da dieses eine neue
Schnittstelle ähnlich GLX [10] benötigen würde.
Der Einsatz von GLX wird allgemein abgelehnt, da dies wieder eine X Abhängigkeit
mit sich bringen würde. Dies bedeutet natürlich einen erheblichen Verlust an
Funktionalität und reine OpenGL Anwendungen können nicht trivial einfach auf
Wayland portiert werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass bisher nur die freien Treiber das Projekt Wayland
in Angriff genommen haben. Ob z. B. NVIDIA daran arbeitet, Wayland zu unterstützen,
ist bisher nicht bekannt [11].
Nouveau [12] ist leider kein allgemein einsetzbarer
Ersatz für den proprietären Treiber. Man denke hier an Anwendungsfälle wie
garantierte Abwärtskompatibilität, Energieverwaltung, die
Programmierschnittstelle CUDA [13] und
patentierte Technologien, die nur im proprietären Treiber verfügbar sind.
Die für die Zukunft angedachte Möglichkeit einen X-Server unter Wayland zu
betreiben, existiert auch nur in Gedanken. Ein kompletter Wechsel auf Wayland ist
daher aktuell nur möglich, wenn man in Kauf nimmt, dass keine X-Anwendung mehr
funktioniert. Dies ist ein akzeptabler Preis für mobile Einsatzgebiete wie
MeeGo [14] oder KDE Plasma Active [15].
X-Server bleibt erhalten
Auf den Plattformen Desktop und Netbook kann von einem reinen Wayland-System daher
auf absehbare Zeit keine Rede sein. Es gibt zu viele Anwendungen, die auf
Legacy-Unterstützung angewiesen sind und bei denen auch keine Portierung auf Wayland zu
erwarten ist.
Gerade auch die Tatsache, dass Wayland nicht auf allen Plattformen funktioniert
(siehe NVIDIA Treiber) macht deutlich, dass für die großen Desktopumgebungen
wie die KDE Plasma Workspaces [16] vorerst X11 die erste
Wahl bleiben muss. Eine zu frühe Umstellung auf Wayland würde Regressionen mit
sich bringen und für die KDE Plasma Entwickler ist es das höchste Gebot, den
Desktop nicht zu zerstören.
Auch nach einer erfolgten Umstellung auf Wayland muss die X11 Unterstützung
erhalten bleiben. Auch wenn die meisten Anwender Wayland verwenden können, wird
es auf lange Zeit noch Anwendungsfälle geben, die einen X-Server erfordern. Die
Desktopumgebungen müssen daher in ihrer Entwicklung die Kompatibilität mit X
berücksichtigen. Wird die Abwärtskompatibilität nicht berücksichtigt, so
könnte im schlimmsten Fall Wayland von den Nutzern abgelehnt werden und sie
bleiben bei X11.
Umstellung auf Wayland
Für die KDE Plasma Entwickler gibt es mehrere Möglichkeiten wie man Wayland
angehen könnte. Diese sind:
- das Ignorieren von Wayland;
- das Ignorieren von X11;
- einen neuen, auf Wayland basierten Compositor und eine Desktop Shell parallel entwickeln;
- die schrittweise Migration auf Wayland.
Offensichtlich sind die ersten zwei Optionen nicht praktikabel. Wie in der
Einleitung gezeigt, bietet Wayland eine verbesserte Architektur, von der die KDE
Plasma Workspaces auch profitieren sollen. Die zweite Option ist nicht möglich,
da wie im letzten Abschnitt gezeigt, der X-Server uns auf absehbare Zeit erhalten
bleibt. Eine Einstellung der Entwicklung für X11 würde zu großen
Akzeptanzproblemen unter den Nutzern führen.
Auch die dritte Option ist nur schwer umzusetzen. Natürlich mag es verlockend
klingen, eine alte Codebasis, zugeschnitten für ein nun obsoletes Fenstersystem, zu
verwerfen. Jedoch stecken in KWin mehr als 12 Jahre Entwicklung und
Fenstermanagement-Expertise. Durch Wayland ändert sich das grundlegende
Verhalten jedoch nicht: ein Fenster ist immer noch ein Fenster. Zieht man noch
die verfügbaren Entwicklerresourcen hinzu, wird offensichtlich, dass es nicht
möglich ist, gleichzeitig an den X11 Workspaces zu entwickeln und nebenher noch
einen neuen Wayland Workspace zu entwickeln.
Die zweite und dritte Option kommen auch mit dem großen Problem, dass es einen
Tag X gibt an dem die allgemeine Umstellung von X11 auf Wayland erfolgen würde.
Dies hätte vermutlich ähnliche Auswirkungen wie die Umstellung von KDE 3.5 auf
KDE Plasma Workspaces. Vieles wäre unfertig und schlecht getestet, die Akzeptanz
der Nutzer vermutlich eher schlecht. Nutzer würden lieber auf X11 bleiben, womit
nichts gewonnen wäre.
Die Umstellung der KDE Plasma Workspaces
Wie aus dem letzten Abschnitt ersichtlicht werden durfte, planen die KDE Plasma
Entwickler keine direkte Umstellung auf Wayland. Die Portierung wird in drei
Phasen erfolgen:
- Unterstützung von Wayland Clients unter X11;
- Wayland Clients unter Wayland;
- X11 Clients unter Wayland.
Aktuell arbeiten die Entwickler an der ersten Phase. Der Compositor und Fenstermanager KWin wurde um erste Wayland-Unterstützung
erweitert [17]. Der
Compositor kann im OpenGL ES 2.0/EGL-Backend Wayland Clients verwalten und in den
Scenegraph integrieren. Jedoch hat jeder Wayland Client noch eine X11-Abhängigkeit. Jeder
Client muss mit einer X11-Fensterdekoration versehen werden, um Eingabeereignisse
im Compositor abfangen zu können (zur Erinnerung: X11 bietet keine Input
Redirection) und an den Client weiterzuleiten.
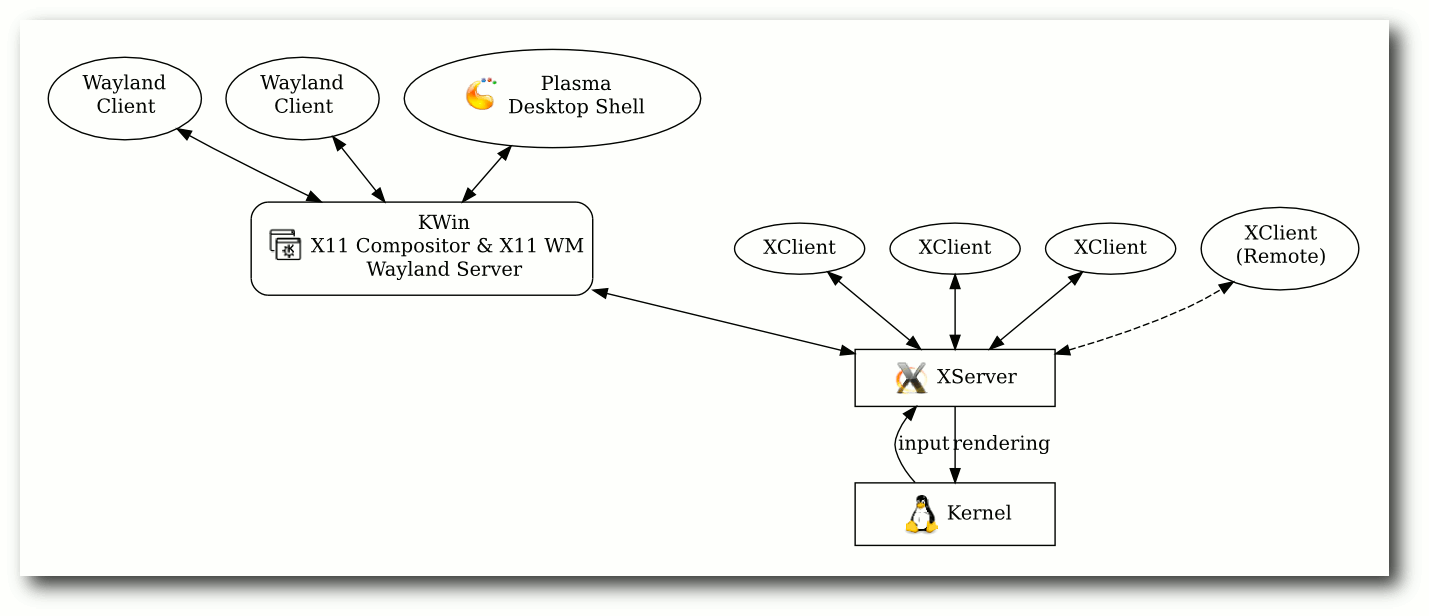
Wayland Clients unter einem X11 Compositor.
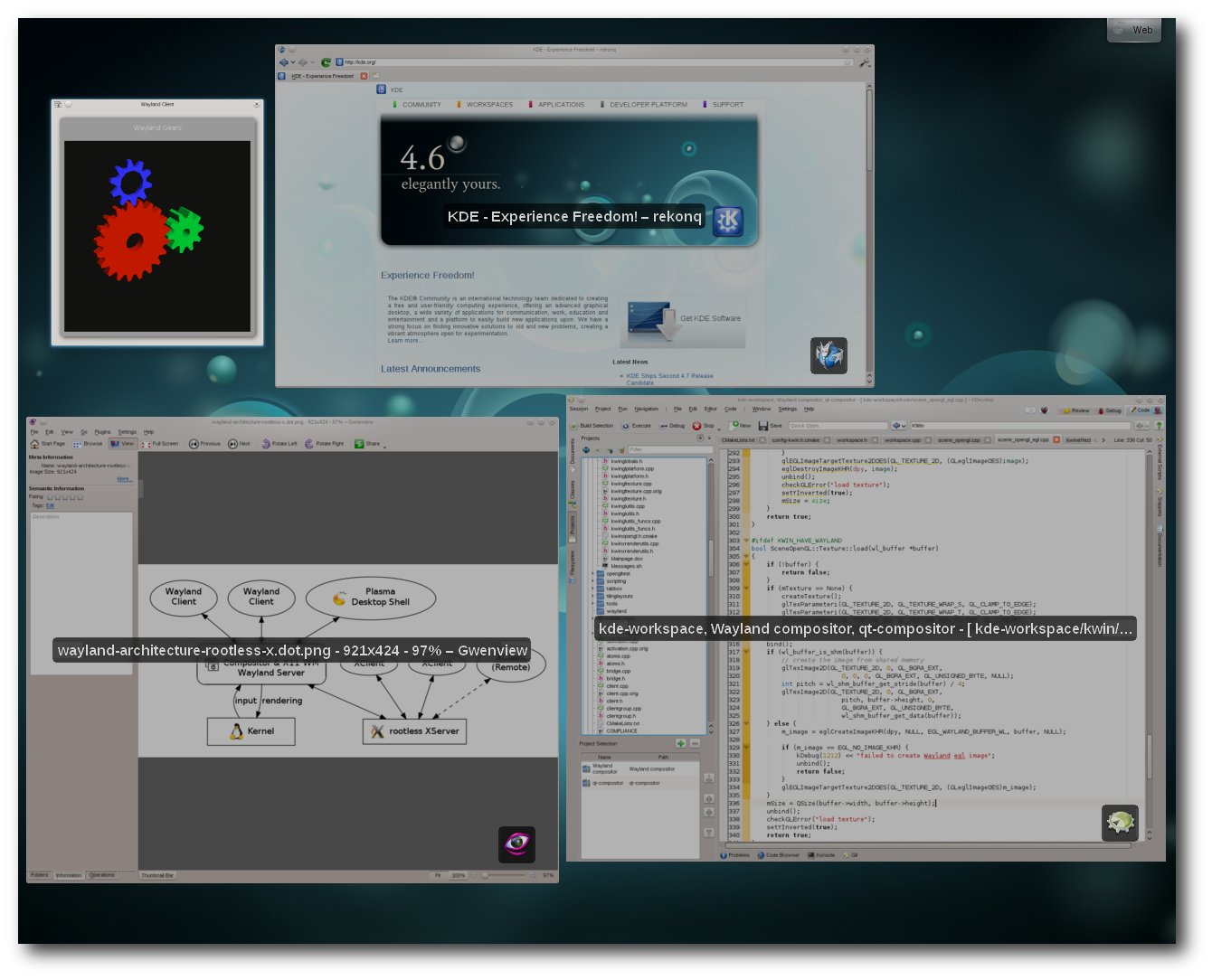
Wayland Fenster (Zahnräder) wie ein normales X11 Fenster in den Compositor integriert.
Aber nicht nur der Compositor muss Unterstützung erhalten. Auch der Plasma
Desktop muss initialen Support erhalten, um z. B. Wayland Clients im Tasks Applet
anzeigen zu können. Viele dieser Funktionen sind X11 spezifisch und müssen nun
in generische Funktionen umgewandelt werden: die X11 Funktionalität muss in ein
Backend ausgelagert werden.
Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass im Gegensatz zu den KDE-Anwendungen
(welche auch auf Microsoft Windows und Mac OS X portiert sind) der Workspace nie
dazu vorgesehen war, unter einem anderen Fenstersystem als X11 zu funktionieren. Dank
einer guten Abstraktionsschicht ist es jedoch gelungen, den Plasma-Desktop auch
auf Microsoft Windows zu portieren und die ersten Ergebnisse der KWin-Portierung
zeigen, dass auch dieses Projekt machbar ist. Hierbei wird das Verwalten der
Fenster abstrahiert und die eigentliche Interaktion mit den Fenstern in
Fenstersystem-spezifische Backends verlagert, ähnlich der bereits verwendeten
Backend-Architektur im Compositing-Bereich [18] (KWin unterstützt XRender, OpenGL 1.x/GLX, OpenGL
2.x/GLX und OpenGL ES 2.0/EGL als Backends).
Bei der zweiten Phase geht es darum, einen Workspace ohne X11
Laufzeitabhängigkeit zu erstellen. Dieser würde dann ausschließlich Wayland
Clients verwalten können. Dieser Entwicklungsschritt baut teilweise auf der
ersten Phase auf.
Voraussetzung hierfür ist, dass
Wayland-Fenster bereits verwaltet und gezeichnet werden
können. Nun ist es erforderlich, direkt auf der Hardware zum Rendern aufzusetzen
und Inputereignisse weiterzuleiten, ohne den X-Server dazwischen zu haben.
Die Entwicklung der Phase 1 und 2 werden teilweise parallel erfolgen
können. Auch hier hat bereits die Arbeit begonnen: mit Hilfe eines Google Summer
of Code Projekts [19] wird der
KWin Quellcode abstrahiert und die X11 Interaktion in ein Backend verlagert mit
dem Ziel, Wayland Clients ohne X11 Abhängigkeit zu verwalten.
Die dritte Ausbaustufe ist erst von Interesse, wenn Phase eins und zwei umgesetzt
sind. Hierbei geht es im Prinzip um ein „Umdrehen“ der ersten Phase. Anstatt
Wayland-Clients unter X11, sollen nun X11-Clients unter Wayland verwaltet werden.
Wie dieses umgesetzt werden kann,
ist noch nicht klar. Am wahrscheinlichsten
sind die Optionen, das X11-Protokoll im Compositor umzusetzen oder
einen „root-less“ X-Server zu starten.
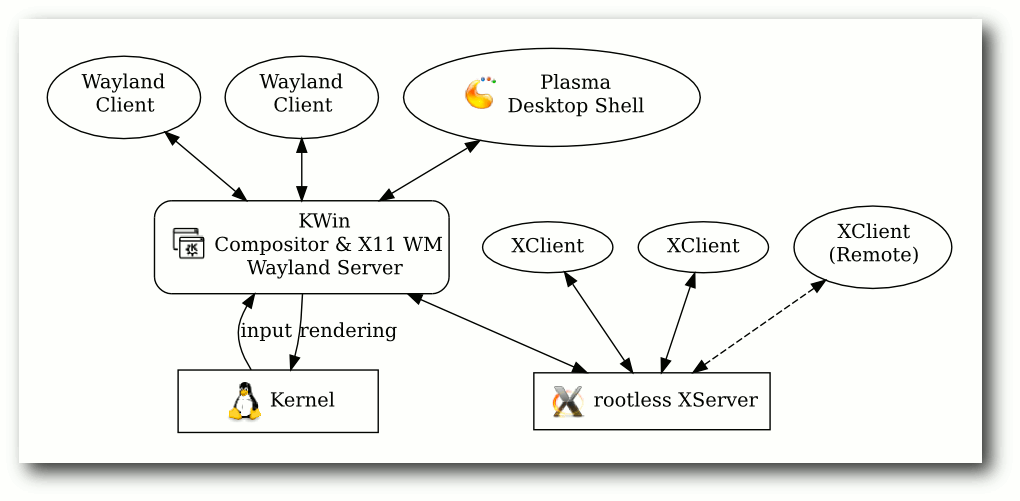
X-Server unter einem Wayland Compositor.
Ziel der gesamten Entwicklung ist es, dass der Anwender niemals weiß, ob er
unter X11 oder Wayland arbeitet und ob ein Fenster nun ein X11 oder Wayland
Fenster ist. Von der Benutzung her sollen sich die Systeme nicht unterscheiden.
Erst nach Abschluss der zweiten Phase kann man beginnen, neue, nur
Wayland-spezifische, Erweiterungen einzubauen.
Ausblick
An dieser Stelle ist es nun angebracht, einen Ausblick zu liefern, wann die
Anwender mit Wayland arbeiten werden können. Dies ist natürlich sehr schwierig.
Wayland ist immer noch eine sehr junge Technologie und mögliche Probleme, welche
die Entwicklung behindern könnten, sind noch nicht abzusehen.
Grundsätzlich plant die KDE Plasma Community, wie am Desktop Summit in Berlin
vorgestellt, im Winterrelease 2012 die Phase eins bereits als Entwicklervorschau
zu integrieren. Das Ziel ist es, Anwendungs- und Workspaceentwicklern etwas in die
Hand zu geben, um ihre Anwendung unter Wayland zu testen. Natürlich ist das auch
für interessierte Anwender eine Option, um sich früh mit den neuen
Möglichkeiten vertraut zu machen, jedoch wird vom produktiven Einsatz von
Wayland Clients zu diesem frühen Zeitpunkt abgeraten und die Entwickler werden
noch keine Bugreports dafür annehmen.
Die zweite Ausbaustufe wird parallel gestartet und zielt auf die KDE Plasma
Active Initative. Hierzu hatten die Entwickler bei ihrem Tokamak V
Sprint [20] bereits Ende April sich
als Ziel gesetzt, das zweite Release auf Wayland aufzubauen. Als mobile Plattform
ist genauso wie für MeeGo der Verlust von, unter X11 bekannter, Funktionalität
kein Problem und dieser Formfaktor profitiert am meisten durch ein Ausschalten
des X-Servers.
Somit wird nach aktueller Planung das Sommerrelease 2012 es ermöglichen, einen
X-freien Workspace zu betreiben. Jedoch wird dieser auf dem Desktop kaum einsetzbar
sein, da noch zu viel fehlen wird. Wie lange es tatsächlich dauern wird, bis ein
komplett einsetzbarer Wayland Desktop zur Verfügung steht, ist aktuell noch
nicht absehbar.
Links
[1] http://wayland.freedesktop.org
[2] https://desktopsummit.org/program/sessions/compositing-after-x-kwin-road-wayland
[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-03
[4] http://de.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Compositing_manager
[6] http://www.youtube.com/watch?v=BrK4c7iFJLs
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Stacking_window_manager
[8] http://www.khronos.org/opengles/
[9] http://www.opengl.org/
[10] http://de.wikipedia.org/wiki/GLX
[11] http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?p=2343452#post2343452
[12] http://nouveau.freedesktop.org/wiki/
[13] http://de.wikipedia.org/wiki/Compute_Unified_Device_Architecture
[14] https://meego.com/
[15] http://community.kde.org/Plasma/Active
[16] http://kde.org/workspaces/
[17] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/06/discovering-a-new-world/
[18] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/05/the-compositing-modes-of-kde-plasma-workspaces-explained/
[19] http://www.google-melange.com/gsoc/project/google/gsoc2011/aarlt/12001
[20] http://vizzzion.org/blog/2011/04/tokamak-in-nijmegen/
| Autoreninformation |
| Martin Gräßlin (Webseite)
arbeitet als KWin Maintainer aktiv an der Portierung von KWin
nach Wayland und hielt auf dem Desktop Summit 2011 einen Vortrag zu diesem Thema.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer
Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.
Als weiter Wegpunkt auf dem Weg zu Kernel 3.0 wurde Anfang Juli -rc6 [1] veröffentlicht. Ein großer Anteil der enthaltenen Änderungen betrafen den neuen Treiber isci für Intels C600 Chipsatz, der im Zusammenspiel mit Xeon-Prozessoren zum Einsatz kommt. Torvalds rechnete nicht damit, dass dieser Treiber Probleme machen sollte und dachte auch schon darüber nach, das Release folgen zu lassen. Dazu kam es dann jedoch erst einmal nicht, denn mit -rc7 [2] folgte eine weitere Vorabversion, da die Änderungen an RCU (Read-Copy-Update), das gleichzeitige Zugriffe auf Speicherbereiche regeln soll, immer noch Probleme im Zusammenspiel mit dem Scheduler aufwiesen. Diese konnten (hoffentlich) beseitigt werden, sodass Torvalds schließlich den Kernel 3.0 [3] freigab.
Linux 3.0
Während der Entwicklungsphase hat Torvalds es oft genug erwähnt, nun ist es offensichtlich: Linux 3.0 sticht nicht durch irgendwelche besonderen Funktionen heraus, auch wurde diesmal nicht mit alten Konzepten gebrochen, wenn man von der dreistelligen Versionsnummer einmal absieht. Den Vergleich mit 2.6.38 samt dessen Wunder-Patch oder mit 2.6.37, der erstmals ohne den Big Kernel Lock auskam, oder mit 2.6.29, bei dem erstmals Kernel Modesetting eingeführt wurde, kann der neue Kernel nicht standhalten, dafür verlief die Entwicklung jedoch recht ruhig, was auf einen guten Kernel mit wenig Ausbesserungen im Nachgang hoffen lässt. Daneben hat 3.0 auch einen neuen Namen erhalten: „Sneaky Weasel“, also gewieftes – oder auch hinterlistiges – Wiesel.
Ein paar Neuerungen hat jedoch auch auch Linux 3.0 parat: So defragmentiert Btrfs nun seine Partitionen automatisch. Dies ist notwendig, da Btrfs als Copy-on-Write-Dateisystem Daten nicht an die alte Stelle der Partition zurück- und damit überschreibt, sondern auf einem freien oder zumindest nicht mehr genutzten Teil ablegt. Die dadurch entstehende Verteilung eigentlich zusammengehöriger Daten, Fragmentierung genannt, wirkt sich auf die Geschwindigkeit beim Lesen des Datenträgers negativ aus, wogegen die Defragmentierung hilft. Dies kann manuell angestartet werden oder Mittels der Option autodefrag beim Einbinden der Partition während der Nutzung automatisch erfolgen. Weitere Verbesserungen bei Btrfs sind die Integritätsprüfung des Dateisystems mittels Scrubbing und schnelleres Löschen und Anlegen von Dateien. Netzwerkkommunikation kann mittels des neuen Syscalls sendmmsg() beschleunigt werden. Dabei reicht der eine Aufruf aus, um eine Menge an Daten zu versenden, für die ansonsten mehrere Aufrufe von sendmsg() notwendig wären. Das Konzept folgt recvmmsg(), das bereit in Kernel 2.6.33 eingeführt wurde.
Eine lange Geschichte hat der Paravirtualisierer Xen [4] aufzuweisen. Nachdem bereits seit Jahren Distributoren ihre Kernel entsprechend modifizieren oder angepasste Kernel in ihren Quellen anbieten, kann Linux nun auch von Haus aus als Host-System arbeiten, die Unterstützung für die privilegierte Domäne, im Xen-Jargon dom0 genannt, ist nun endlich in den Linux-Kernel eingezogen.
Fehlersuche im Netzwerk erfordert oftmals Zugriff auf Netzwerkpakete auf unterster Ebene im System, direkt bevor Bits und Bytes in elektrische Signale auf dem Netzwerkkabel gewandelt werden. Hierzu dient BPF (Berkeley Packet Filter [5]), der das heraussuchen der gewünschten Netzwerkpakete übernimmt, als Schnittstelle für entsprechende anwenderseitige Werkzeuge wie tcpdump. Dabei erhält BPF Anweisungen zum Filtern in einer eigenen Syntax. BPF hat nun einen Compiler erhalten, der die an BPF übergebenen Anweisungen beim Aufruf in Maschinen-Code (bislang nur für die x86-64-Architektur) umsetzt, welcher vom System schneller abgearbeitet werden kann als der bisherige BPF-Code und so speziell auf netzwerkseitig gut ausgelasteten Systemen eine Verbesserung der Leistung bringt.
Eine weitere kleine Neuerung ist Wake-on-WLAN, womit der PC aus dem Ruhezustand aus der Ferne geweckt werden kann. Hierbei bleibt der WLAN-Adapter aktiv und lauscht weiterhin auf eingehende Pakete. Das Ping-Kommando, mittels dem die Netzwerkverbindung zu einem anderen Rechner geprüft werden kann, kann nun auch ohne root-Rechte genutzt werden. Hierfür wurde ein neues Protokoll für Sockets eingeführt, das nur ICMP-Nachrichten verarbeiten kann. Natürlich muss das Ping-Kommando entsprechend angepasst sein, um Nutzen aus dieser Änderung ziehen zu können.
Wie immer sind die Änderungen auf Kernel Newbies in englischer Sprache übersichtlich aufgeführt [6].
Links
[1] https://lkml.org/lkml/2011/7/4/320
[2] https://lkml.org/lkml/2011/7/11/427
[3] https://lkml.org/lkml/2011/7/21/455
[4] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Xen
[5] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Berkeley_Filter
[6] http://kernelnewbies.org/LinuxChanges
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite)
hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels. Dafür erfährt er frühzeitig Details über neue Treiber und interessante Funktionen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Herbert Breunung
Nachdem im vorigen Teil (freiesMagazin 07/2011 [1])
die Perl-Geschichte, Perl-Philosophie und
Gemeinschaft der Nutzer vorgestellt wurde, beginnt jetzt die Reise
zum ersten eigenen Perl-Programm.
Nachdem geprüft ist, ob alle
wichtigen Werkzeuge funktionstüchtig und griffbereit verpackt sind,
geht es zum ersten Etappenziel: Skalare Variablen und einfache IO.
Die weitere Route darf durch die Kommentarfunktion am Ende des
Artikels mitbestimmt werden.
Wir brauchen Perl und ein Ziel
Wer dieses Magazin liest, tut das wohl vor seinem Bildschirm, der
vom Linux seiner Wahl mit Pixeln versorgt wird. Selbst Mac-Nutzer
haben wenigstens ein Unix unter der Haube und somit Perl bereits
installiert. Wen das launige Schicksal jedoch ins Fensterland
verschlug, bekommt mit Strawberry Perl [2]
nach wenigen Klicks eine Arbeitsumgebung mit Perl, Make und
C-Compiler, die es ihm erlaubt, diesem Tutorium vollständig zu
folgen. Denn hier wird für die echte Praxis geübt, nicht für
geschönte Realitätsausschnitte. Dieses Tutorium wird Folge für
Folge ein brauchbares Programm aufbauen und dabei jeden Schritt
dokumentieren, damit die Leser gut vorbereitet sind und in jeder
digitalen Wildnis Ideen umsetzen können.
Außerdem macht es wesentlich mehr Spaß, ein Programm nach eigenen
Wünschen anzupassen, als beinah sinnlose Codeschnipsel abzutippen.
Das geplante Programm ist ein Notizbuch, weil es eine kleine,
praktische Sache ist, die jeder ab und an gut gebrauchen kann und
das Linux eigene Programm Note auf externe Editoren zurückgreift und
nicht immer einfach zu bedienen ist. Je nach zugesandten Anregungen
wird es am Ende zwitschern können oder es erlauben, dass Notizen
von mehreren Nutzern in Echtzeit bearbeitet werden.
Der Anfang
Der Anfang ist jedoch ganz einfach, lediglich ein Rechner und etwas
logisches Denkvermögen werden vorausgesetzt. Und natürlich ein
aktuelles Perl, mindestens Version 5.12. Ein kurzes
$ perl -v
in der Kommandozeile (auch Shell oder Terminal) gibt Auskunft, was
installiert ist. Wer jetzt 5.10 liest, wird an einigen Stellen
kleinere Abstriche machen müssen. Aber spätestens mit einem 5.8.x
sollte man über eine Aktualisierung nachdenken und die
Paketverwaltung bemühen. Wer das nicht darf oder es nicht riskieren
möchte, weil wichtige Programme oder eigene Projekte von Perl
abhängig sind und er nicht wieder alle Module neu aufspielen will,
sollte sich das Modul Perlbrew [3]
installieren (lassen). Auch Menschen, welche die vielen Module, die
während dieses Tutoriums vorgestellt werden, nur testweise
installieren möchten oder die es nicht mögen, hinter dem Rücken der
hauseigenen Paketverwaltung zu installieren, sollten den folgenden
Abschnitt sorgfältig lesen, alle anderen dürfen ihn ignorieren.
Perl und Module installieren
Um Module zu installieren wird hier
CPANMINUS [4]
empfohlen, weil es nicht konfiguriert werden muss, sehr einfach zu
bedienen ist und keine Ausgaben macht, die Anfänger verwirren
könnten. Wer es nicht hat, wird noch einmal auf den Standardclient
CPAN zurückgreifen müssen und kann sehen was mit „verwirrenden
Ausgaben“ gemeint war:
# cpan App::cpanminus
Wenn die letzte Zeile der Ausgabe
/usr/bin/make install -- OK
lautet, weiß man, dass alles gut ging. Nun folgt im Terminal mit
Root-Rechten:
# cpanm App::perlbrew
Jetzt kann man sich überzeugen, dass die darauf folgende Ausgabe
wesentlich kompakter und verständlicher ist. Sie endet hoffentlich
mit:
Successfully installed App-perlbrew-0.27
1 distribution installed
Wer unter Unix rechtlich davon ausgeschlossen ist, außerhalb seines
Homeverzeichnisses etwas zu tun oder das Tutorium als Experiment sieht, welches
er jederzeit nach /dev/null schicken kann, installiert Perlbrew
lokal mit:
$ curl -L http://xrl.us/perlbrewinstall | bash
Dies lädt das Skript perlbrewinstall herunter und leitet es an
die Bash weiter, die es dann ausführt und damit Perlbrew installiert.
Damit die Brauerei ihren Betrieb aufnehmen kann, muss noch die
~/.bashrc (oder die jeweilige Konfigurationsdatei der aktiven
Shell) um Folgendes erweitert werden:
PATH="$HOME/perl5/perlbrew/bin:$PATH"
source perl5/perlbrew/etc/bashrc
Nutzer der C-Shell setzen $PATH mit setenv und setzen in die
zweite Zeile ein cshrc statt dem bashrc.
Die letzten Schritte der Einrichtung sind sehr einfach und werden
auch erklärt, wenn man nur perlbrew eingibt. Ähnlich zu hg oder
git (zwei Versionsverwaltungsprogrammen) braucht es zuerst ein
$ perlbrew init
Das Verzeichnis, in dem man dies tut, ist nicht wichtig. Mit
$ perlbrew available
kann man sich auflisten lassen, was derzeit aktuell ist. Im Sommer 2011 wird dies auf ein
$ perlbrew install perl-5.14.1
hinauslaufen. Nun ist etwas Geduld gefragt, weil es einige Minuten
dauert, Perl und seine Kernmodule zu laden, zu kompilieren und zu
testen und Perlbrew dabei einfach nur schweigt.
Nach einem Neuaufruf der Shell mit exec oder einem neuen
Terminalfenster und einem einmaligen
$ perlbrew switch 5.14.1
ist das aktuelle Perl endlich aktiv und wird immer gerufen, wenn man
perl eingibt. (Der Interpreter wird klein geschrieben, die
Sprache groß und PERL schreibt nur, wer es auf einen unfreundlichen
Besuch aus der Perlgemeinde ankommen lassen will.)
Um zum System-Perl zu wechseln, genügt ein
$ perlbrew off
was sich jederzeit mit dem obigen switch wieder rückgängig machen lässt.
Dabei sollte man beachten, dass alles, was der Nutzer, der sich
Perlbrew installierte, in der Shell tut, sich immer auf das aktive
Perl bezieht, egal ob man Module installiert, Dokumentation liest
oder Werkzeuge benutzt, welche mit Perl geliefert werden. Jedes
nach dem switch geöffnete Terminal bezieht sich auf die lokale
Installation (in ~/perl5/perlbrew/perls/perl-5.14.1), auch nach
einer Neuanmeldung oder Neustart des Systems.
Mein erstes Programm
Andere Einsteigertutorien nehmen sich mehr Zeit, das allererste
Programm zu bejubeln. Klar, es ist es ein großartiges Gefühl mit
einem simplen print "Hallo ihr da draussen" ein richtiges
Programm geschrieben zu haben, wo man doch bisher Programmieren für
eine schwarze Kunst gehalten hat. Diesen Moment der Begeisterung
sollte jeder einmal genossen haben. Und wenn man dabei nicht
nachdenken muss, was #include <stdio.h> oder
class HelloWorldApp bedeutet, umso besser. Aber irgendwann meldet sich
das Gehirn: „Und wozu ist das jetzt gut? Alle Perlmodule im
Verzeichnis auszugeben hätte wenigstens noch einen praktischen
Nutzen.“
$ perl -e 'print "tschuess\n"'
$ perl -E 'say <*.pm>'
print kennt man vielleicht aus Ruby, Python, Java oder PHP. Es
gibt den ihm folgenden Wert, hier ein mit (doppelten)
Anführungszeichen markierter Text, auf der Standardausgabe aus, was
meist die aktive Shell ist, von der aus perl gestartet wurde. Die
zweite Zeile gibt alle auf .pm endenden Dateien im aktuellen
Verzeichnis aus, was meist Perl-Module sind. Jeder, der nicht zum
ersten mal ein Terminal öffnet, kann das verstehen, aber kaum eine
Sprache ermöglicht das so kompakt ohne zwei, drei andere Befehle aus
dem Werkzeugkasten zu holen, die mit dem Problem nichts zu tun
haben und vom Neuling auch erst einmal begriffen werden müssen.
Mit der Option -e oder -E führt perl sofort das in (hier in
einfache) Anführungszeichen gestellte als Programm aus. Die großen
Perl-Magier geben so direkt ihre Zaubersprüche ab, ohne Stab und
Editor. Im Folgenden wird jedoch ein Editor benutzt, denn das
Programm wird stark wachsen.
Die meisten Leser haben sicherlich bereits eine feste Meinung,
welcher Editor der beste ist und die besseren bieten alles, was
während dieses Tutoriums gebraucht wird. Unentschlossene könnten
Padre [5] oder
Kephra [6] probieren, welche beide in
Perl geschrieben sind, also per cpanm beziehbar sind. Padre
bietet mehr IDE-artige Funktionen, wohingegen Kephra eher auf
Konsistenz und das schnelle Bearbeiten von Text ausgerichtet ist.
Das Projekt vorbereiten
Das neue Projekt bekommt am besten ein eigenes Verzeichnis und einen
alias in der .bashrc:
alias bn='perl $HOME/code/perl/betternote/bn.pl'
So kann es jederzeit einfach verwendet werden. Denn nur, wer öfters
benutzt, was er entwickelt, merkt auch, was noch verbessert werden
kann. Ebenso wird sich der Stolz auf das eigene Programm nur so
voll zeigen. Datei- und Verzeichnisnamen sind dabei nur Vorschläge.
Wichtig ist nur zu wissen, dass Perlskripte meist mit perl
Dateiname aufgerufen werden:
$ perl ~/perl/script.pl
$ ~/perl/script.pl
Die zweite Variante kann aber nur gewählt werden, wenn mit chmod
oder über den Dateibrowser (Rechtsklick auf die Datei und dann
„Eigenschaften -> Zugriffsrechte“) die Rechte der Datei auf
ausführbar gesetzt wurden und die erste Zeile der Datei die
sogenannte Shebang
#!/usr/bin/perl
enthält (siehe auch „Shebang – All der Kram“, freiesMagazin
11/2009 [7]).
Dies ist natürlich nur unter Unix sinnvoll und auch nur, wenn nicht
Perlbrew verwendet wird. Deshalb verwendet der vorgeschlagene
alias die erste Variante. Windows-Nutzer legen sich statt des
Alias eine Verknüpfung der .pl-Datei auf den Desktop. Einfach die
Datei auswählen (einfacher Linksklick), mit der rechten Maustaste
das Kontextmenü aufklappen und eine Verknüpfung erstellen, die dann
auf den Desktop ziehbar ist.
Perls Format
Bevor es endlich wirklich losgeht, noch ein paar allgemeine Regeln,
die zu kennen alles sehr viel einfacher macht.
Regel 1: Leerzeichen spielen (fast) keine Rolle. Solange man sich
nicht innerhalb der vielen Arten von Anführungszeichen befindet
oder print als pri nt schreibt, ist es vollkommen gleich, wo
und wie viele Leerzeichen oder Zeilenanfänge stehen.
print
'huhu' ;
Regel 2: Semikolons trennen die Befehle. Solange andere Befehle
nicht eingreifen, arbeitet perl das Programm Befehl für Befehl
von oben nach unten und links nach rechts ab. Da Zeilenenden nicht
anzeigen können, wo ein Befehl aufhört, macht es das Semikolon.
Auch wenn man nach dem letzten Befehl eines Programms oder
Teilprogramms kein Semikolon setzen muss, empfiehlt Perl-Guru
Damian Conway es trotzdem zu tun. Das beugt späteren Problemen vor,
wenn man einen Befehl schnell mal in ein anderes Programm kopieren
möchte. Sein Buch „Perl Best Practices“ enthält viele solcher
nützlichen Hinweise und hat deshalb einen hohen Stellenwert bei
vielen Perl-Programmierern.
Regel 3: Die Raute (#) leitet Kommentare ein. Wenn man etwas in
das Programm schreiben möchte, das der Interpreter ignorieren soll,
fügt man eine Raute ein und alles von diesem Zeichen bis zum
nächsten Zeilenende gehört nicht zum ausgeführten Programm. Für
längere Kommentare nimmt man POD, das später vorgestellt wird und
ein __END__ oder __DATA__ markiert das Ende eines Programms.
say 'yes'; # und ich dachte Perl
# sei schwer
say 'pound sign: #'; # ab hier ist
# Kommentar
Sag es einfach
Was macht eigentlich dieses say, was man hier schon zweimal sehen
konnte? Es ist eigentlich nicht viel mehr als ein print, das noch
ein
Steuerzeichen anfügt, welches die Zeile beendet. Die nächste
Ausgabe beginnt dann in einer neuen. In Ruby und C nennt sich das
puts, in Python funktioniert das print auf diese Art.
Das say ist sehr praktisch, denn es lässt sich sehr leicht tippen.
Die Buchstaben s, a und y liegen auf der normalen QWERTZ-Tastatur
nebeneinander. Außerdem ist es kürzer, spart bis zu sechs
Anschläge und tut letztlich genau das, was man in den meisten
Fällen mit print machen will. Es wurde allerdings erst mit
Perl-Version 5.10 eingeführt und muss einzeln oder mit allen
anderen Neuerungen angemeldet werden, mit denen ältere Programme
vermeidbare Probleme haben könnten.
use feature 'say';
# oder
use v5.10;
Benutz es einfach
Neue Projekte sollten aber darauf nicht verzichten. Deshalb wird die
erste Zeile des Notizprogramms nach der Shebang
use v5.12;
sein. Somit hat das Programm nicht nur Zugang zu allen neuen und
interessanten Funktionen, es spart auch eine Zeile, die zuvor allen
Anfängern in Perl-Foren eingebläut wurde und
die man endlich nicht mehr so oft erwähnen muss, weil sie mit
use v5.12; aufgerufen wird:
use strict;
Was dieser Befehl genau macht, erklärt der nächste Abschnitt.
Einfach gesagt findet er für den Programmierer viele seiner
Tippfehler.
Dass use „benutze“ heißt, weiß man vielleicht noch aus dem
Englischunterricht. Aber in Perl kann es dreierlei bedeuten: Wenn
eine Zahl folgt, prüft es die Version des laufenden perl. Ist es
älter, wird sofort abgebrochen. Ab Version 5.10 aktiviert es, wie
bereits beschrieben, alle neuen Funktionen bis zur angegebenen
Version. Der vorhin verwendete Kommandozeilenparameter -E lädt
alle verfügbaren neue Funktionen.
Folgt dem use ein Name, sucht perl nach einer gleichnamigen
Datei die auf .pm endet und lädt sie als Modul. Manche sagen auch
Bibliothek dazu. Da daher 95% der Macht aller Programme kommt,
sollte der Befehl eigentlich noch vor print gelehrt werden.
Durch Gewohnheitsrecht hat sich durchgesetzt, dass Modulnamen in
„CamelCase“ [8]
also wie SuperModul geschrieben werden, aber mindestens mit einem
Großbuchstaben beginnen. Steht nach use etwas Kleingeschriebenes,
ist es kein Modul sondern ein „Pragma“, d. h. ein Befehl an Perl,
sich anders zu verhalten. Nach strict ist das zweitnützlichste
Pragma warnings, was perl veranlasst, ausführlichere
Fehlermeldungen zu geben. Wer sich sich gerne belehren lässt, kann
sogar diagnostics aktivieren. Dann werden zu den Warnungen die
Erklärungen aus perldiag (eine Seite der Perl-Dokumentation)
angezeigt.
Skalarvariablen
Selbst wer noch nie programmiert hat, kennt Variablen wohl vom
Mathematikunterricht. Da sind es Buchstaben, die für eine Zahl stehen,
die zu berechnen ist. Für Programmierer sieht das aber etwas anders
aus. Hier sind Variablen eine Art Kiste (Speicherplatz), in die man
jederzeit einen anderen Wert hineintun kann. (Außer in streng
funktionalen Sprachen wie Haskell natürlich.) Die Namen der Kiste
darf man in Perl beliebig wählen, solange sie mit einem Buchstaben
anfangen. Bei Verwendung des Pragmas utf8 kann man sogar Umlaute
oder japanische Katagana für Variablen und andere eigene Konstrukte
verwenden.
In vielen anderen Programmiersprachen gibt man den Kartons neben dem
Namensschild noch eine Inhaltsbeschreibung und zeigt so an, ob man
Zahlen oder doch lieber Kartoffeln in der Kiste abzulegen gedenkt.
Bei Perl steckt diese Inhaltsangabe in einem Sonderzeichen, das vor
dem Variablennamen steht: $, @ oder %, wobei es in diesem
Teil des Tutoriums nur um die einfachen gehen soll, die mit $
beginnen. Das $ sieht aus wie ein S und erinnert den Benutzer,
dass es ein Skalar, also ein einfacher Wert, ist. Andere Sprachen
unterscheiden da auch noch zwischen ganzen Zahlen, gebrochenen
Zahlen, Buchstaben, Text und vielem mehr. Aber Perl ist das alles
erst einmal egal.
$n = '5';
say $n + 3;
Damit wird ein kleiner Text (alles was in Anführungszeichen steht!)
in die Kiste namens $n getan. = weist das Ergebnis der rechten
Seite der linken zu. Eine Zeile später wird damit gerechnet. Da
Perl weiß, was gemeint ist, lautet das Ergebnis natürlich 8. Manche
Programmierer würden sich bei sowas die Haare raufen, weil das jede
Computerlogik verletzt. Larry Wall versucht es aber „normalen“
Menschen einfach zu machen, in deren Alltag + sich auf Zahlen
bezieht, nicht auf Schriftzeichen. Dann muss halt perl den
Mehraufwand betreiben und prüfen, ob ein Wert auch als Zahl
verstanden werden kann, nicht der Programmierer. Ein Text wird aber
nur als Zahl deutbar, wenn er auch mit einer Ziffer beginnt. Ist
die Zeichenkette leer ("), entspricht das einer 0.
Wurde der Variablen beim ersten Erwähnen kein Wert gegeben, ist sie
nicht leer, sondern hat keinen definierten Inhalt, was $var = undef;
oder undef $var; entspricht. Bei ja/nein-Entscheidungen
ist ", 0 oder undef negativ, alles andere positiv.
Strikte Regeln
So wie das letzte Beispiel dort steht, würde es einen Fehler
hervorrufen. Wenn man eine Variable zum ersten Mal erwähnt, muss
man dazuschreiben, in welchem Bereich sie bekannt ist. In der
Informatik sagt man Gültigkeitsbereich. Das wären für den Anfang
die Befehle my oder our:
my $notiz = 'Ich wollt nur mal Tach sagen.';
our $gruss = 'Tach!';
$notiz „lebt“ nur bis zur nächsten schließenden, geschweiften
Klammer (nur im aktuellen Block), $gruss dagegen im ganzen
„Modul“. (Das war etwas gemogelt, reicht aber als erste
Vereinfachung.) Wäre kein my oder our angegeben, gäbe es diese
Variable im ganzen Programm. Vor 20 Jahren, als Perlskripte klein
waren, spielte das keine Rolle, aber heute wäre es wie das Fahren
ohne Gurt. Man bräuchte nur ein Modul benutzen, dass ein Modul
benutzt, in dem es auch eine Variable $notiz gibt, die während
eines selbst ausgelösten Befehls verändert wird. Es könnten Wochen
vergehen, bis so eine Problemursache überhaupt gefunden wird.
Deshalb schränkt man den Geltungsbereich von Variablen möglichst
stark ein und beide $notiz können koexistieren ohne voneinander
Notiz zu nehmen. Genau dafür wurde use strict; erfunden. Es
zwingt, immer einen Geltungsbereich zu bestimmen, was man sonst
nicht müsste und verbietet damit globale Variablen (überall
bekannte). Der angenehme Nebeneffekt davon ist, sollte man sich
verschreiben ($notitz), gibt es einen harten Fehler (compile
error) und das Programm bricht ab, bevor es ausgeführt wurde,
weil vor dem $notitz kein my stand. Dabei gibt Perl die
Zeilennummer samt Inhalt der schlimmen Stelle an und ein Fehler
weniger konnte sich einschleichen.
IO „von Hand“
Bis jetzt ist das Programm sehr klein:
#!/usr/bin/perl
use v5.12;
use warnings;
# use diagnostics; # nur wer mag
print "Notiz: ";
my $notiz = readline STDIN;
Die letzte Programmzeile liest vom Benutzer ein, was immer er in die
Shell tippt und mit „Enter“ absegnet. Weil die Entertaste aber ein
Zeichen abgibt, das die Zeile abschließt (das gleiche unsichtbare
Zeichen, dass den Unterschied zwischen print und say ausmacht),
kommt auch die ganze Zeile Text in $notiz an. readline
(englisch für „lese Zeile“), tut dies auch und STDIN sagt von wo
(der Standardeingabe, das in den meisten Betriebsystemen das
Terminal ist, aber auch auf eine Braillezeile oder anderes
umgeleitet sein kann). Perl wäre nicht Perl wenn das nicht auch
kürzer ginge. Statt readline lässt sich auch der am Anfang
gezeigte Diamantoperator <> nehmen. Nur wenn er ein Muster
bekommt, sucht er damit die Dateinamen im aktuellen Verzeichnis ab.
Und solange das Skript keine Parameter bekommt, ließe sich sogar
STDIN weglassen:
my $notiz = <>;
chomp $notiz;
Da das Zeilenendzeichen in $notiz nicht wirklich gebraucht wird,
schneidet man es mit chomp ab. Manche schreiben lieber beides in
einer einzigen Zeile, was Geschmackssache ist:
chomp( my $notiz = <> );
Bereits die äußerlich sehr
unterschiedlichen Arten eine Zeile einzulesen, zeigt die
Wahlmöglichkeiten, für die Perl geliebt und abgelehnt wird und die
im vorigen Teil angesprochen wurden.
Doch wohin mit der Notiz? Sie sollte bis zum nächsten Programmstart
erhalten bleiben, was Variablen niemals leisten können. Dateien schon,
da diese sicher auf der Festplatte lagern, zumindest solange
kein großes Magnetfeld zu Besuch kommt.
Um eine Datei zu öffnen, verwendet man den Befehl open. Dieser
bekommt drei mit Komma getrennte Information dahinter, die auch
Parameter genannt werden: erstens das Handle, zweitens den Modus
und drittens den Dateinamen. Dateinamen sind erst einmal normaler
Text. Die möglichen Modi sind lesen (<), schreiben (>), anfügen
(>>). Für Lese- und Schreibzugriffe stellt man ein + davor
(+<). Aus den Pfeilzeichen lässt sich mehr Sinn ableiten, wenn
man sich merkt, dass wenn die Spitze in den Dateinamen zeigt,
damit schreiben gemeint ist und umgekehrt. Es lassen sich Modus und
Dateiname auch als ein Text angeben, dies ist aber nicht empfohlen.
Wie Handle funktionieren, ist dem Leser schon bekannt, denn STDIN
ist so eines. Diese Schreibweise (ohne $) zu verwenden, wird aber
auch nicht empfohlen, weil es globale Variablen sind, die use strict;
nicht verbieten kann. Deshalb sollte man Skalare nehmen,
in denen die Handle gespeichert werden und die genau wie ein Handle
verwendet werden. Sobald die Lebensdauer des Skalars erreicht ist,
wird die Datei freigegeben, was auch jederzeit mit close
geschehen kann. Um die Datei für einen Schreibzugriff
vorzubereiten, muss Folgendes eingetippt werden:
open my $FH, '>', 'notizblock.txt';
print $FH $notiz;
close $FH;
print oder say sind eigentlich Universalwerkzeuge, um Text
irgendwohin zu verschicken. Was bisher geschah war insgeheim ein:
print STDOUT $notiz;
STDOUT ist das Handle für die Standardausgabe, was auch meist nur
das Terminal ist. Wichtig ist: Zwischen Handle und Text sollte man
kein Komma setzen. Da print seine Nachricht auch in mehreren,
durch Komma getrennten Happen erhalten kann, braucht es einen Weg,
das Handle unterscheiden zu können. Die Nachricht wird wie folgt
aus der Datei gelesen:
open my $FH, '<', 'notizblock.txt';
$notiz = <$FH>;
close $FH;
Statt readline (a.k.a. <>) geht auch read, um eine genau
bestimmte Anzahl von Bytes zu lesen:
read( $FH, $notiz, 1);
Bei einem Zeichen wäre allerdings getc („get character“, zu deutsch „bekomme ein Zeichen“)
kürzer, was vor allem für Abfragen wie [J/N] effektiv ist und das chomp spart:
$notiz = getc $FH;
Das Ergebnis vom read ist die Anzahl der Zeichen, die tatsächlich
gelesen werden konnten und eof $FH kann melden, ob man schon am
Ende der Datei angekommen ist (eof ist kurz für „end of file“).
Aufgabe
Aus allem Vorgestellten ein vollständiges Programm zu machen, soll
die Hausaufgabe für das nächste Mal sein. Dafür fehlt allerdings
noch eine Information. Mit dem obigen Aufruf übernimmt das Skript
das aktuelle Arbeitsverzeichnis ($CWD) der Shell. Startet also
jemand perl projekte/note/bn.pl von E:\Perl aus und im Code
wird ein open $FH, '<', 'notizblock.txt'; ausgeführt, sucht Perl
E:\Perl\notizblock.txt. Die Textdatei sollte aber im
Projektverzeichnis liegen und das Skript muss auch dort nachsehen,
egal von wo aus gestartet. Dafür bring Perl das Kernmodul (ist
immer dabei) FindBin mit, welches das ermöglicht:
use FindBin;
chdir $FindBin::Bin;
chdir wechselt das Arbeitsverzeichnis (wie cd in der Shell unter
Linux und Windows) und $FindBin::Bin ist einfach eine mit our
angemeldete Variable des Moduls, in der das gewünschte Verzeichnis
gespeichert ist. Ansonsten bitte keines der jetzt gezeigten Module
benutzen.
IO-Module
Auf die gezeigte Art können Dateien nur in Portionen (meist Zeilen)
gelesen und geschrieben werden. Es sei denn, man kennt den Trick mit
my $notiz = do { local $/; <$FH> };
wodurch der ganze Dateinhalt in $notiz landet. Das ist aber auch
nicht die perfekte Lösung. Zum Glück hat Uri Guttman bereits vor
Jahren File::Slurp geschrieben. Dadurch geht alles sauber, knapp,
in einem Befehl und ohne Handle:
use File::Slurp;
my $notiz = read_file( 'notizblock.txt' ); # lesen
write_file( 'notizblock.txt', $notiz ); # schreiben
append_file( 'notizblock.txt', $notiz ); # anhaengen
Da Golf (das kürzeste Programm gewinnt) der Sport der echten
Perlprogrammierer ist, gibt es noch eine kürzere Lösung, dank des
ebenfalls legendären Brian Ingerson. Sein IO::All kann alles, das
irgendwie mit Ein- oder Ausgabe zu tun hat. Damit lässt sich sogar
ein Uhrzeitserver mit einer Zeile Perl schreiben. Doch in diesem
Teil interessiert nur lesen und schreiben von Dateien:
use IO::All;
$notiz < io('notizblock.txt'); # lesen
io('notizblock.txt') > $notiz; # auch lesen
$notiz > io('notizblock.txt'); # schreiben
$notiz >> io('notizblock.txt'); # anhaengen
$notiz < io('-'); # STDIN lesen
Die offizielle Dokumentation
Mit Perl kommt eine Dokumentation, die recht gut ist und an der ab
Version 5.14 wieder stärker gearbeitet wird. Eine erste Übersicht
über die dort enthaltenen Themen listet
$ perldoc perl
auf. Die Hilfe zu perldoc selber liefert
$ perldoc perldoc
$ man perldoc
Die gleiche Dokumentation kann auch auf
perldoc.org [9] nachgeschlagen werden.
Einen kleinen Teil der perldoc gibt es auch übersetzt im Wiki der
perlcommunity.de [10].
Eine Liste mit fast sämtlichen anderen Perl-Ressourcen ist dort auch
verlinkt [11].
Ausblick
Sobald man mehr als einen Wert hat, sollte man die Variablen kennen,
die mit @ beginnen. Die nächste Folge wird genau das
behandeln, denn
der Notizblock soll eine Liste an Notizen verwalten
können. Auch die verschiedenen Formate, in denen sich Werte
(Literale) deklarieren lassen, werden voraussichtlich erklärt.
Zusätzlich sei noch einmal daran erinnert, dass über die
Kommentarfunktion am Ende des Artikels auch Wünsche
zum weiteren Verlauf des Tutoriums
geäußert werden
können.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-07
[2] http://strawberryperl.com/
[3] http://www.perlbrew.pl/
[4] http://metacpan.org/module/App::cpanminus
[5] http://padre.perlide.org/
[6] http://kephra.sourceforge.net/site/de
[7] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2009-11
[8] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Camelcase
[9] http://perldoc.org/
[10] http://wiki.perl-community.de/foswiki/bin/view/Perldoc/WebHome
[11] http://wiki.perl-community.de/foswiki/bin/view/Wissensbasis/PerlWebSites
| Autoreninformation |
| Herbert Breunung (Webseite)
ist seit sieben Jahren mit Antworten, Vorträgen, Wiki- und
Zeitungsartikeln in der Perlgemeinschaft aktiv.
Dies begann mit dem
von ihm entworfenen Editor Kephra.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Dadurch, dass man in LaTeX eigene Befehle definieren kann, lassen
sich wiederkehrende Aufgaben bzw. Formatierungen leicht umsetzen,
ohne unnötig LaTeX-Code mehrfach schreiben zu müssen. Ein zweiter
Vorteil bei einem eigenen Befehl besteht darin, dass man bei einer gewünschten
Änderung nur eine Textstelle bearbeiten muss und nicht mehrere separate
Stellen im Dokument. Der Artikel soll zeigen, wie man mithilfe des
Paketes xkeyval [1]
optionale Argumente bei selbstdefinierten LaTeX-Befehlen nutzen
kann, ohne den Überblick zu verlieren.
Das Paket xkeyval ist dabei eine Erweiterung des Paketes
keyval [2],
mit welchem man einen Großteil der Beispiele des Artikels auch
nachvollziehen kann. Daneben gibt es noch
pgfkeys [3] und
kvoptions/kvsetkeys [4] [5],
die mit einer Schlüsselbehandlung bei Optionen umgehen können.
Befehlsdefinition
Eigene Befehle definiert man durch das Kommando \newcommand.
Das folgende Minimalbeispiel wird im Laufe des Artikels um neue
Befehlsdefinitionen erweitert:
\documentclass[parskip=half-]{%
scrartcl}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
% Blindtext zum Testen
\newcommand*\lorem{%
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum.}
\newcommand\framedtextA[1]{%
\fbox{#1}}
\begin{document}
\framedtextA{\lorem}
\end{document}
Listing: framedtextA.tex
Hier wird der Befehl \framedtextA definiert, der genau ein
Argument erwartet ([1]) und dieses dann in einer simplen Box umrahmt
darstellt. Mittels #1 kann man dann auf das Argument zugreifen.
Hinweis: Damit man irgendetwas zum Darstellen hat, wird ein
Blindtext über das Kommando \lorem definiert.
In der aktuellen Definition hat dies natürlich den Nachteil, dass
\fbox die Zeilen nicht automatisch umbricht, sodass man den Inhalt
besser in eine Minipage setzt und \framedtextA wie folgt korrigiert:
\usepackage{calc}
\newcommand\framedtextA[1]{%
\fbox{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
#1%
\end{minipage}}}
Listing: framedtextA.tex (2. Version)
Damit die Box um die Minipage genau so breit ist, wie die
aktuelle Zeile, wird von der aktuellen Zeilenlänge \linewidth
die Rahmenstärke \fboxrule (auf beiden Seiten) sowie der
Rahmenabstand \fboxsep (ebenfalls auf beiden Seiten) abgezogen.
Damit die Rechnung funktioniert, benötigt man das LaTeX-Paket
calc [6].
Als nächstes soll der Befehl erweitert werden, bis er so kompliziert
bei der Benutzung wird, dass man sich eine Alternative wünscht.
Rahmenstärke und -abstand angeben
Als erste Erweiterung soll man die Rahmenstärke und den Abstand
zum innenliegenden Text angeben können:
\newcommand\framedtextB[3]{%
\begingroup%
\setlength{\fboxrule}{#1}%
\setlength{\fboxsep}{#2}%
\fbox{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
#3%
\end{minipage}}%
\endgroup}
Listing: framedtextB.tex
Die Benutzung im Dokument wäre dann:
\framedtextB{3pt}{10pt}{\lorem}
was den gleichen Text wie zuvor in einer Box darstellt, wobei der
Rahmen aber eine Breite von 3 Punkt (3pt) hat und der Abstand zum
Text 10 Punkte (10pt) beträgt.
Hinweis: Für die Befehle wird \begingroup … \endgroup
genutzt, damit die Veränderung von \fboxrule oder
\fboxsep am Ende eines Befehls automatisch aufgehoben wird.
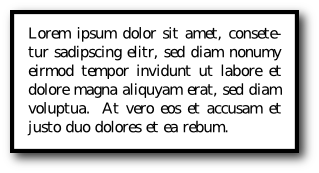
Die Box mit \framedtextB.
Textfarbe ändern
Etwas bunter darf es ruhig zugehen, daher soll der Text farbig
dargestellt werden. Dafür benötigt man das LaTeX-Paket
xcolor [7]:
\usepackage{xcolor}
\newcommand\framedtextC[4]{%
\begingroup%
\setlength{\fboxrule}{#1}%
\setlength{\fboxsep}{#2}%
\fbox{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\textcolor{#3}{#4}%
\end{minipage}}%
\endgroup}
Listing: framedtextC.tex
Die Benutzung ist:
\framedtextC{3pt}{10pt}{red}{\lorem}
Das erstellt den Text in der Box in roter Farbe.
Hinweis: Das Paket xcolor wird dem Paket color
vorgezogen, da es eine weitaus bessere Farbunterstützung bietet und einen
kleinen Fehler in \fcolorbox korrigiert.
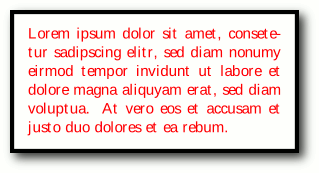
Die Box mit \framedtextC.
Rahmen- und Hintergrundfarbe ändern
Da der Befehl \framedtextC immer noch recht überschaubar ist,
soll auch die Rahmenfarbe und die Hintergrundfarbe verändert werden
können:
\newcommand\framedtextD[6]{%
\begingroup%
\setlength{\fboxrule}{#1}%
\setlength{\fboxsep}{#2}%
\fcolorbox{#4}{#5}{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\textcolor{#3}{#6}%
\end{minipage}}%
\endgroup}
Listing: framedtextD.tex
Die Benutzung ist nun:
\framedtextD{3pt}{10pt}{white}{green}{black}{\lorem}
was den Text weiß auf schwarzem Hintergrund darstellt und dies
alles grün umrahmt.
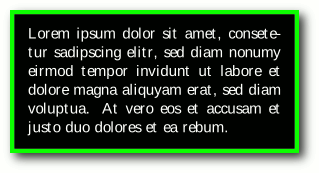
Die Box mit \framedtextD.
Textausrichtung festlegen
Da die Darstellung im Blocksatz innerhalb der Box ziemlich
langweilig ist, soll man von außen auch auf rechtsbündigen,
linksbündigen oder zentrierten Text umschalten können.
Der Einfachheit halber wird dabei mit einem optionalen siebten
Argument gearbeitet, welches man in eckigen Klammern nach der
Anzahl der Argumente angibt. Für die Entscheidung, welche
Ausrichtung gewählt wird, wird das Paket
xifthen [8] benutzt:
\usepackage{xifthen}
\newcommand\framedtextE[7][b]{%
\begingroup%
\setlength{\fboxrule}{#2}%
\setlength{\fboxsep}{#3}%
\fcolorbox{#5}{#6}{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\ifthenelse{\equal{#1}{r}}%
{\flushright}{%
\ifthenelse{\equal{#1}{l}}%
{\flushleft}{%
\ifthenelse{\equal{#1}{c}}%
{\centering}{%
\ifthenelse{\equal{#1}{b}}%
{}%
{\error{1}}}}}%
\textcolor{#4}{#7}%
\end{minipage}}%
\endgroup}
Listing: framedtextE.tex
Jetzt schwillt der Aufruf zu folgendem Konstrukt an, wenn der Text
rechtsbündig ausgegeben werden soll:
\framedtextE[r]{3pt}{10pt}{black}{black}{white}{\lorem}
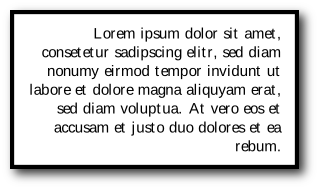
Die Box mit \framedtextE.
Dies kann man jetzt noch eine Weile fortführen, spätestens beim
zehnten Argument stößt man aber auf eine natürliche Begrenzung von
LaTeX, denn man wird dezent darauf hingewiesen, dass man bereits
neun Parameter hat:
! You already have nine parameters
Und wer sich – ohne die Definition von \framedtextE
anzuschauen – auch noch nach einem Monat gemerkt hat, welche Angabe
die Text-, Rahmen- oder Hintergrundfarbe bzw. Rahmenstärke und
-abstand ändert, hat ein wirklich gutes Gedächtnis.
Bei derartig vielen Parametern wäre es besser,
wenn die Benutzung etwas intuitiver vonstatten
ginge. So wäre es nicht schlecht, wenn man klare Begriffe mit
einer Farbe assozieren könnte, oder wenn die Reihenfolge der Angaben
beliebig ist. Und es ist auch nicht gerade sinnvoll, dass man
grundsätzlich diese ganzen Angaben machen muss, selbst wenn man
überall die Standardwerte nutzen möchte.
Hinweis: Für neue Umgebungen mittels \newenvironment gelten im
Übrigen die gleichen Aussagen.
Argumente mithilfe von xkeyval
Glücklicherweise hat sich schon jemand Gedanken zu den obigen
Wünschen gemacht. Mit dem LaTeX-Paket xkeyval kann man alle
Probleme umgehen, die sich gestellt haben. Der folgende Abschnitt
soll anhand von Beispielen die Benutzung des Paketes aufzeigen,
sodass auch ein LaTeX-Anfänger relativ schnell zu einem Ergebnis
kommt. Für eine ausführliche Beschreibung aller Optionen und
Möglichkeiten sollte man sich die Dokumentation auf der Webseite
durchlesen.
Bei der Benutzung von xkeyval werden die optionalen Argumente nach
sogenannten „Schlüssel-Wert-Paaren“ durchsucht. Zu jedem Schlüssel
wird dann der zugehörige Wert ausgelesen und der LaTeX-Schreiber
kann den Wert entsprechend weiterverarbeiten. Manchmal wird dieser
direkt an ein weiteres LaTeX-Kommando weitergegeben, manchmal aber
auch erst zwischengespeichert, um später darauf zugreifen zu können.
Die Angabe eines Schlüssels und des zugehörigen Wertes geschieht
dabei in der Regel über die Angabe key=value.
Farbangaben der Box ersetzen
Als Erstes sollen die drei Farbangaben für die Text-, Rahmen- und
Hintergrundfarbe so geändert werden, dass man diese als optionales
Argument angeben kann.
Als Basis für die Änderung wird die Version \framedtextD
von oben benutzt. Die Möglichkeit zur Ausrichtung des Textes wird
dann später wieder eingefügt.
Zuerst sollte man sich für die drei Farben drei neue Befehle
definieren, die den Farbnamen enthalten und später überschrieben
werden:
\newcommand*\TextColor{black}
\newcommand*\BackgroundColor{white}
\newcommand*\BorderColor{black}
Danach kann man auch schon mit der Definition der neuen Schlüssel
beginnen:
\makeatletter
\define@key{TextBox}{textcolor}{%
\renewcommand*\TextColor{#1}}
\define@key{TextBox}{background}{%
\renewcommand*\BackgroundColor{#1}}
\define@key{TextBox}{bordercolor}{%
\renewcommand*\BorderColor{#1}}
\makeatother
Dies war es auch schon. Mittels \define@key definiert man also
einen neuen Schlüssel. Das erste Argument (TextBox) gibt dabei die
Familie an, die später für die Identifikation benutzt wird. Das
zweite Argument steht für die Schlüsselbezeichnung. Als drittes
folgt der LaTeX-Code, in dem man den Schlüssel verarbeitet, auf den
man mittels des Argumentes #1 zugreifen kann. Im obigen Fall
werden die drei Werte also einfach nur in den vordefinierten
Kommandos zwischengespeichert.
Der neue Befehl sieht dann wie folgt aus:
\newcommand\framedtextF[4][]{%
\setkeys{TextBox}{#1}%
\setlength{\fboxrule}{#2}%
\setlength{\fboxsep}{#3}%
\fcolorbox{\BorderColor}{%
\BackgroundColor}{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\textcolor{\TextColor}{#4}%
\end{minipage}}%
}
Listing: framedtextF.tex
Wichtig ist die Zeile
\setkeys{TextBox}{#1}%
denn über diese gibt man alle optionalen Argumente, die im ersten
Argument (#1) stehen, an xkeyval zur Interpretation. Dieses sucht
dann darin nach Schlüsseln und Werten und führt den zugehörigen
Code aus. Hierbei ist es wichtig, die richtige Familie anzugeben,
da sonst die Schlüssel nicht erkannt werden.
Nach dem Setzen der Schlüssel kann man über die Kommandos
\BorderColor, \BackgroundColor und \TextColor auf die
Farbdefinitionen zugreifen.
Eine Benutzung sieht dann wie folgt aus:
\framedtextF[textcolor=white,bordercolor=green,background=black]{3pt}{10pt}{\lorem}
Dies ist zwar länger als zuvor, hat aber den Vorteil, dass aufgrund
der Assoziation mit einem Schlüsselwort wie textcolor sofort
klar ist, was das Argument beeinflusst. Daneben ist auch die Reihenfolge
der Angaben nicht mehr relevant:
\framedtextF[background=black,textcolor=white,bordercolor=green]{3pt}{10pt}{\lorem}
erzeugt die gleiche Box.
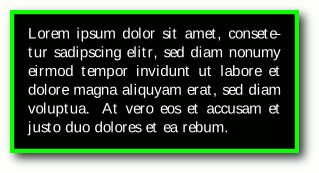
Die Box mit \framedtextF.
Da es sich um optionale Werte handelt, kann man natürlich auch nur
einen Teil angeben, beispielsweise
\framedtextF[textcolor=black]{3pt}{10pt}{\lorem}
Das Ergebnis ist nicht wie erwartet, da der Text „verschwunden“ ist.
Der Grund liegt darin, dass noch keine Standardwerte definiert
wurden. Das heißt, fehlt ein optionales Argument, wird es derzeit
nicht verändert und bei erneuter Anwendung von \framedTextF
einfach der zuvor gesetzte Wert beibehalten. Dadurch sieht man nun
(neuen) schwarzen Text auf (altem) schwarzen Hintergrund.
(Wobei etwas getrickst und die Gruppierung entfernt wurde, um
diesen Effekt zu zeigen.)
Fehlende Schlüssel vorbelegen
Will man vorbelegte Standardwerte nutzen, wenn die Angabe einer Option
komplett fehlt, fügt man folgende Zeile (am besten unter der Definition
der Schlüssel) ein:
\presetkeys{TextBox}{%
bordercolor=black,textcolor=black,%
background=white}{}%
Erzeugt man nun das LaTeX-Dokument mit gleichem Code wie oben,
wird der Hintergrund weiß angezeigt, sodass man den schwarzen Text wieder
sehen kann. Wer nicht glaubt, dass das funktioniert, kann auch die
Textfarbe auf Rot ändern:
\framedtextF[textcolor=red]{3pt}{10pt}{\lorem}
Der Befehl \presetkeys definiert wie gesagt die Standardwerte,
wenn eine Option nicht angegeben ist. Das erste Argument gibt
wieder die Familie an. Das zweite und dritte Argument sind ähnlich,
denn das zweite setzt die Standardwerte bevor die
benutzerdefinierten Werte mit \setkeys gesetzt werden, das dritte
Argumente setzt diese erst danach. Die Standardwerte werden dabei
aber nur gesetzt, falls der Wert nicht als Option vom Benutzer
angegeben wurde.
In obigem Beispiel hat die Unterscheidung, ob man die Standardwerte
zuerst oder zuletzt setzt, keine Bedeutung. Dies ist aber
beispielsweise dann wichtig, wenn man in einer Schlüsseldefinition
auf einen anderen Schlüsselwert zugreifen will. Näheres dazu erfährt
man in der Dokumentation.
Die Vorbelegung bleibt aktiv, bis sie mit \presetkeys
erneut überschrieben wird. Das heißt, man kann in jedem Befehl
vor \setkeys die Vorbelegung anders setzen, wenn das gewünscht ist.
Hinweis: Natürlich muss man \presetkeys nicht einsetzen,
sondern kann auch selbst für eine Vorbelegung sorgen, indem man
vor dem \setkeys-Befehl alle Werte selbst mit
\renewcommand initialisiert. Alternativ kann man auch
ein zweites \setkeys aufrufen, um Werte einmalig zu setzen.
Boxgrößen ändern
Wie oben bei den Farben soll natürlich entsprechend mit den Größenangaben
zu Rahmenstärke und Rahmenabstand verfahren werden. Hier kann man
zuerst mit der Zwischenspeicherung der Längen wie oben beginnen:
\newlength{\BorderWidth}
\newlength{\BorderSeparation}
\makeatletter
\define@key{TextBox}{border}{%
\setlength\BorderWidth{#1}}
\define@key{TextBox}{bordersep}{%
\setlength\BorderSeparation{#1}}
\makeatother
Die Vorbelegung sollte man auch nicht vergessen:
\presetkeys{TextBox}{%
bordercolor=black,textcolor=black,%
background=white,border=0.8pt,%
bordersep=3pt}{}
Und natürlich benötigt man noch ein neues Kommando:
\newcommand\framedtextG[2][]{%
\begingroup%
\setkeys{TextBox}{#1}%
\setlength{\fboxrule}{%
\BorderWidth}%
\setlength{\fboxsep}{%
\BorderSeparation}%
\fcolorbox{\BorderColor}{%
\BackgroundColor}{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\textcolor{\TextColor}{#2}%
\end{minipage}}%
\endgroup}
Listing: framedtextG.tex
Die Benutzung im Standardfall sieht nun ganz einfach aus:
\framedtextG{\lorem}
Oder mit einem etwas dickeren und grünen Rahmen wie folgt:
\framedtextG[bordercolor=green,border=3pt]{\lorem}
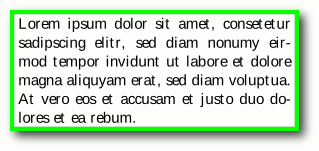
Die Box mit \framedtextG.
Eigentlich ist diese Lösung aber umständlich, da man die Längen für
\fboxrule und \fboxsep auch gleich ohne Umwege setzen kann.
Dafür entfernt man die beiden \newlength-Zeilen wieder und ersetzt
die Definition der Schlüssel sowie den Befehl \framedtextG durch:
\makeatletter
\define@key{TextBox}{border}{%
\setlength\fboxrule{#1}}
\define@key{TextBox}{bordersep}{%
\setlength\fboxsep{#1}}
\makeatother
\newcommand\framedtextG[2][]{%
\begingroup%
\setkeys{TextBox}{#1}%
\fcolorbox{\BorderColor}{%
\BackgroundColor}{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\textcolor{\TextColor}{#2}%
\end{minipage}}%
\endgroup}
Listing: framedtextG.tex (2. Version)
So wirkt das Ganze schon etwas übersichtlicher.
Fehlende Schlüsselwerte vorbelegen
Neben der Vorbelegung mit Standardwerten, wenn der Schlüssel fehlt,
gibt es auch die Besonderheit, einen Schlüssel mit einem Wert
vorzubelegen, wenn der Schlüssel angeben wird, aber kein Wert.
Als sinnvolles Beispiel soll der Rahmen der Box standardmäßig gar
nicht angezeigt werden. Nur wenn man mindestens border
oder border=WERT als Option schreibt, soll ein Rahmen angezeigt werden.
Dafür ändert man die Schlüsseldefinition wie folgt:
\define@key{TextBox}{border}[0.8pt]{\setlength{\BorderWidth}{#1}}
und die Vorbelegung in
\presetkeys{TextBox}{%
bordercolor=black,textcolor=black,%
background=white,border=0pt,%
bordersep=3pt}{}
Das bedeutet also, dass wenn die Option border=WERT bei der Angabe von
\framedtextG fehlt, kein Rahmen angezeigt wird. Schreibt
man dageben nur border, wird der in eckigen Klammern angegebene
vordefinierte Wert bei \define@key benutzt.
Als kleine Übung kann man den Abstand zum Rahmen ebenfalls per
Standard auf 0pt setzen, bei der Angabe von bordersep aber den
Wert 3pt nehmen. Fortgeschrittene LaTeX-Nutzer und xkeyval-Kenner
können versuchen, den Wert bei bordersep in Abhängigkeit von
border zu setzen, denn nur wenn der Rahmen überhaupt sichtbar ist,
ist auch ein Rahmenabstand sinnvoll.
Textausrichtung einstellen
Was jetzt noch fehlt, ist die Einstellung der Textausrichtung. Es
wäre zwar möglich, diese nach wie vor über simple Buchstaben wie
r, l, c oder b zu definieren, nur würde man dann für jede
dieser Optionen einen eigenen Schlüssel benötigen. Und die Frage ist,
was passiert, wenn jemand r,l als Option angibt.
Aus diesem Grund ist es besser, einen Schlüssel align zu definieren,
der nur bestimmte Werte akzeptiert. Hierfür gibt es den sogenannten
\choicekey:
\makeatletter
\define@choicekey{TextAlignment}{%
align}[\val\al]{right,left,center,%
block}
{%
\ifcase\al\relax%
\flushright%
\or%
\flushleft%
\or%
\centering%
\or%
% nichts tun
\fi}
\makeatother
\presetkeys{TextAlignment}{%
align=block}{}
Listing: TextAlignment.tex
Alternativ könnte man auch die Verwendung von align so
ändern, dass der Benutzer immer den echten Befehl angeben muss, also
beispielsweise align=\flushright für rechtsbündigen Text.
Dies erfordert aber, dass der Benutzer die genauen LaTeX-Befehle
kennen muss, und würde außerdem dem Beispiel hier im Artikel die
Grundlage entziehen.
Die Argumente von \define@choicekey sind als Erstes wieder die
Familie, danach das Schlüsselwort und als drittes, optionales Argument
die Zuweisung des Wertes (in unserem Beispiel kann man über al darauf
zugreifen). Danach folgt die Liste der erlaubten zuweisbaren Werte
und zum Schluss der LaTeX-Code, der mittels \ifcase zu den
erlaubten Werten den richtigen Code ausführt. Dabei muss die
Reihenfolge der erlaubten Werte mit den auszuführenden Befehlen
übereinstimmen.
Man sollte bei dem Beispiel aber aufpassen, weil eine neue Familie
TextAlignment benutzt wird. Den Grund dafür zeigt die Definition des
neuen Befehls:
\newcommand\framedtextH[2][]{%
\begingroup%
\setkeys*{TextBox}{#1}%
\fcolorbox{\BorderColor}{%
\BackgroundColor}{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\setrmkeys{TextAlignment}%
\textcolor{\TextColor}{#2}%
\end{minipage}}%
\endgroup}
Listing: framedtextH.tex
Die Schlüssel für die Ausrichtung (englisch „alignment“) dürfen
erst innerhalb der Minipage-Umgebung gesetzt werden, da die daraus
entstehenden Befehle wie \flushleft oder \centering außerhalb
der Umgebung nicht die richtige Wirkung zeigen würden.
Die Familie TextBox kennt aber keinen Schlüssel
align, daher muss dieser ignoriert werden. Man könnte dies
entweder durch die Zeile
\setkeys{TextBox}[align]{#1}%
erreichen, bei dem alle unbekannten Schlüsselworte in den eckigen
Klammern ignoriert werden.
Besser ist aber die Lösung über \setkeys* oben. Alle
in der Familie unbekannten Werte werden in einer extra Liste
gespeichert, die man dann später mittels \setrmkeys
der richtigen Familie zuweisen kann (rm steht für „remaining“).
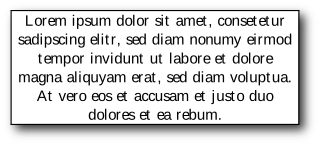
Die Box mit \framedtextH.
Von der unsauberen Lösung
\setkeys{TextBox,TextAlignment}{#1}%
anstelle des \setrmkeys sollte man absehen, da man im
Allgemeinen nicht sicherstellen kann, dass die Schlüsselzuweisung
von TextBox keine negativen Nebeneffekte auf den
LaTeX-Code hat.
Text mit Umbrüchen
Obige Definition von \framedtextH hat den Nachteil,
dass es keine Texte mit mehreren Absätzen zulässt. Als Verbesserung kann man
folgende Definition nutzen:
\newsavebox\MyFrameBox
\newcommand\framedtextI[2][]{%
\begingroup%
\setkeys*{TextBox}{#1}%
\sbox{\MyFrameBox}{%
\begin{minipage}{%
\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
\setrmkeys{TextAlignment}%
\color{\TextColor}%
#2%
\end{minipage}%
}%
\fcolorbox{\BorderColor}{%
\BackgroundColor}{\usebox{%
\MyFrameBox}}%
\endgroup}
Listing: framedtextI.tex
Dadurch wird der Inhalt im Boxregister \MyFrameBox definiert
und dieser erst danach in \fcolorbox
verwendet. Zusätzlich wurde von \textcolor auf
\color umgestellt, da dies sonst mehrere Absätze im Text
verhindern würde.
Die Benutzung ist dann
\framedtextI[border]{\lorem\par\lorem}
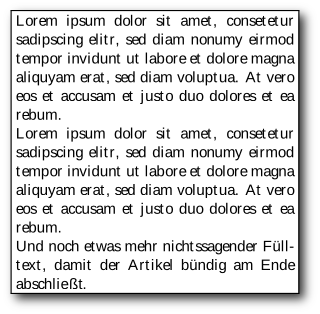
Die Box mit \framedtextI.
Weitere xkeyval-Schlüssel
Es gibt noch zwei weitere Befehle, die für den einen oder anderen Benutzer
wichtig sein könnten. Zum einen:
\define@cmdkey{FAMILIE}{SCHLUESSEL}[STANDARDWERT]{\latex{}-CODE}
Dies definiert, analog zu oben, einen normalen Schlüssel.
Zusätzlich hat man innerhalb des LaTeX-Codes (letztes Argument)
über das Kommando \cmdKV@FAMILIE@SCHLUESSEL Zugriff auf den
Inhalt des definierten Schlüssels.
Der zweite Befehl definiert boolesche Schlüssel:
\define@boolkey{FAMILIE}{SCHLUESSEL}[STANDARDWERT]{\latex{}-CODE}
Diese ähneln \choicekey, denn es sind nur die Schlüsselwerte
true und false erlaubt. Man kann sich zum Beispiel eine
neue boolesche Variable definieren
\newboolean{Variable}
und im LaTeX-Code Folgendes schreiben:
\setboolean{Variable}{#1}
Danach kann man in seinem Code entsprechend des Wertes
unterschiedliche Befehle ausführen:
\ifthenelse{\boolean{Variable}}{%
% Code, falls Variable true ist
}{%
% Code, falls Variable false ist
}
Abschließende Bemerkung
Wie oben angekündigt, geben die im Artikel vorgestellten Beispiele
nur einen kleinen Überblick über das, was man mit xkeyval machen kann.
Dennoch kann man auch als LaTeX-Anfänger sehr schnell gute Resultate
erzielen, wenn man das recht einfache Prinzip verstanden hat. Und
selbst, wenn man nur Copy & Paste nutzt, kommt man womöglich zum Ziel,
auch ohne die Details zu verstehen.
Das LaTeX-Dokument, welches alle Beispiele enthält, kann auch komplett
heruntergeladen werden: framedtext.tex.
Links
[1] http://tug.ctan.org/pkg/xkeyval
[2] http://tug.ctan.org/pkg/keyval
[3] http://tug.ctan.org/pkg/pgfkeys
[4] http://tug.ctan.org/pkg/kvoptions
[5] http://tug.ctan.org/pkg/kvsetkeys
[6] http://tug.ctan.org/pkg/calc
[7] http://tug.ctan.org/pkg/xcolor
[8] http://tug.ctan.org/pkg/xifthen
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
ist Chefredakteur bei freiesMagazin und kümmert
sich dort auch um die Gestaltung der TeX-Infrastruktur. xkeyval hat
sich dabei als sehr großer Helfer herausgestellt.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Das Humble Indie Bundle [1] hat schon
eine gewisse Tradition, so wurde die erste Version bereits im Mai 2010
veröffentlicht. Teil des Bundles sind Spiele, die von verschiedenen
Independent-Studios entwickelt wurden und auf allen großen
Plattformen Linux, Mac OS X und Windows laufen. Ende Juli wurde die
dritte Ausgabe veröffentlicht, auf deren Inhalt in dem Artikel ein
kleiner Blick geworfen werden soll.
Geschichte
Das Humble Indie Bundle wurde erstmals im Mai 2010
veröffentlicht [2].
Es wurde vor allem deswegen bekannt, weil jeder Käufer den Preis
selbst bestimmten konnte. Umso erstaunter waren die Anbieter,
dass nach den zwei Wochen, die das Paket erhältlich war, über
eine Million US-Dollar eingenommen werden
konnte [3].
Den Kaufpreis kann man dabei auf die Spielentwickler, die Anbieter
des Humble Indie Bundles, die Electronic Frontier
Foundation [4] und die Charity-Organisation
Child's Play [5] verteilen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Spielepaketes ist aber auch,
dass die Spiele DRM-frei sind und unter den drei großen Plattformen
Linux, Mac OS X und Windows spielbar sind.
Aufgrund des Erfolges des ersten Paketes, welches u.a. großartige
Spiele wie World of Goo (siehe freiesMagazin
03/2009 [6]),
Aquaria [7] oder Gish (siehe
freiesMagazin 07/2010) [8]
enthielt, gab es im Dezember 2010 ein zweites Spielepaket zu kaufen.
Diesmal waren hervorragende Spiele wie Machinarium (siehe freiesMagazin
02/2010 [9]) und
Osmos (siehe freiesMagazin 07/2010 [10])
dabei.
Im April 2011 gab es dann eine kleine Sonderedition in Form eines
Humble Frozenbyte Bundle [11],
welches nur Spiele der Spieleschmiede Frozenbyte enthielt, darunter
unter anderem Trine (siehe freiesMagazin
07/2011 [12]).
Das dritte Humble Indie Bundle steht seit dem 27. Juli 2011 zum Kauf
bereit. Die Aktion läuft noch bis zum Dienstag, den 9. August 2011,
wird aber gegebenenfalls wie die beiden Bundles zuvor etwas
verlängert. Da das Spielepaket nach der Aktion nicht mehr
erhältlich ist, sollte man zuschlagen, solange man noch kann.
In den nächsten Zeilen wird etwas auf die enthaltenen Spiele
eingegangen, welche zu einem großen Teil aus Physik- und/oder
Denkaufgaben bestehen.
Hinweis: Alle Spiele wurde unter Ubuntu 10.04 64-bit auf einem
Intel Core2 Duo mit 3 GHz, 4 GB RAM und einer NVIDIA-GTX460-Grafikkarte
getestet.
Cogs
Cogs [13] ist ein sehr einfach zu
erlernendes Puzzlespiel. Die Aufgabe ist es, durch das Verschieben
von Platten, auf denen Zahnräder oder Röhren befestigt sind, eine
Maschine anzutreiben, Glocken läuten zu lassen oder ähnliches.
Die einzelnen Elemente müssen so angeordnet werden, dass sie
ineinander greifen. Damit dies nicht zu langweilig ist, befinden
sich die Puzzles manchmal auf mehreren Seiten eines Würfels oder auf
der Vorder- und Rückseite einer Tafel.
Als kleine Herausforderung erhält man Trophäen, wenn man ein Puzzle
innerhalb einer gewissenen Zeit oder mit einer geringen Anzahl von
Zügen erledigt.
Die Spielidee ist nicht sonderlich neu, die grafische Präsentation
ist aber recht hübsch. Entsprechend wurde Cogs auch auf dem Independent
Games Festival 2010 in der Kategorie „Excellence In Design“
nominiert [14].

Wenn die Zahnräder richtig stehen, sieht man dieses lustige Kerlchen aus der Box springen.
VVVVVV
VVVVVV [15] ist ein Jump'n'Run-Spiel,
welches von der grafischen Präsentation stark an die Spiele der C64-Ära
erinnert. Dies tut dem Spielspaß aber keinen Abbruch, sondern
verschafft manchem sicher auch eine Art Nostalgie-Gefühl.
Man selbst übernimmt die Rolle des Raumschiff-Captains Viridian, der
auf eine Raumanomalie stößt, welche die ganzen Crew auf dem Raumschiff
verteilt. Die Aufgabe ist es, sich durch das Raumschiff zu
kämpfen und die Crew zu suchen, wobei weitere Störungen wie
Endlosschleifen oder Portale die Suche nicht einfacher machen.
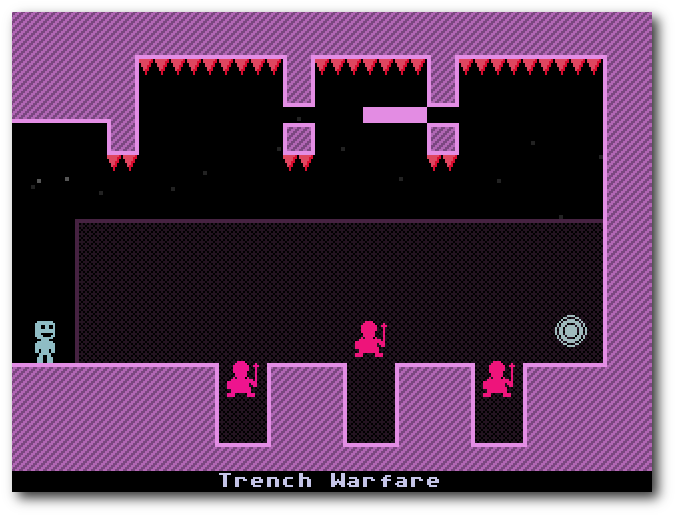
Ein einfaches Durchqueren des Raums ist nicht immer möglich.
Die Steuerung ist sehr simpel, da man sich nur nach rechts und links
bewegen kann. Mit der Aktionstaste kehrt man aber die Gravitation auf
dem Raumschiff um und kann dementsprechend an der Decke entlang gehen.
Dies ist auch notwendig, um alle Räume des Raumschiffes zu erreichen.
Obwohl das Spiel so simpel ist, kann es für einige Stunden fesseln.
Dank der Übersichtskarte sieht man sogar, welche Gebiete des
Raumschiffes man noch nicht erkundet hat. Und gerade das animiert einen
dazu, doch noch den nächsten Raum aufzusuchen.
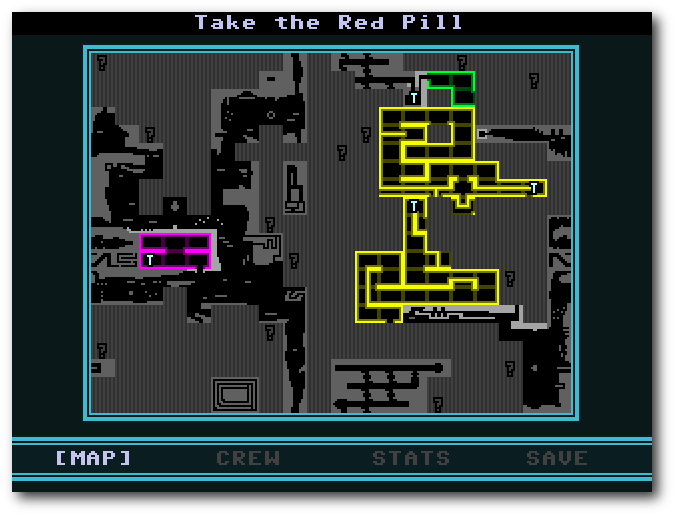
Die Räume des Raumschiffs in der Übersicht.
Crayon Physics Deluxe
Crayon Physics Deluxe [16] ist ein
Physik-Puzzle-Spiel, bei der man sich als Maler austoben kann. Mit
einem Wachsmalstift bewaffnet ist es die Aufgabe, in jedem Level einen
roten Ball zu einem Stern zu bringen. Dabei zeichnet man mit dem Stift
Objekte, die dann mit den vorhandenen Spielelementen physikalisch
korrekt interagieren. So kann man beispielsweise eine Schleuder bauen,
um den Ball zum Stern zu befördern. Das Prinzip erinnert dabei
an das Physik-Spiel Phun (siehe freiesMagazin 04/2008 [17]).
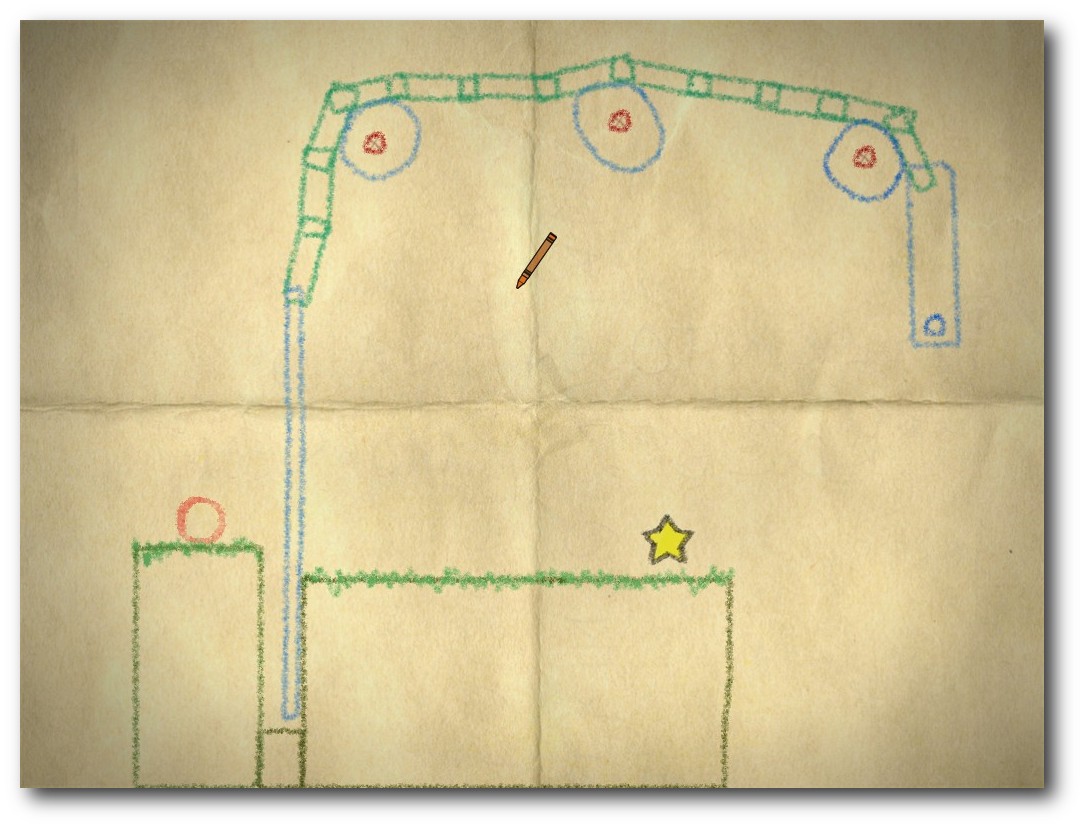
Wie bekommt man den Ball zum Stern?.
Das Spielprinzip ist leicht erklärt, macht aber Spaß. Etwas
Experimentierfreude vorausgesetzt kann man sich sehr lange mit
Crayon Physics Deluxe beschäftigen. Schade ist, dass auf dem
Testrechner der Ton nicht so ging, sodass man sich eine eigene
musikalische Untermalung suchen musste.
Ebenso schade ist es, dass das Spiel nur in Englisch vorliegt. Vor
allem für jüngere Spieler wäre es gut gewesen, auch eine deutsche
Übersetzung anzubieten, denn diese können viel Spaß beim Malen haben.
Für das gute Spielprinzip hat Crayon Physics Deluxe auch zurecht
den Seumas McNally Grand Prize auf dem Independent Games Festival
2008 [18] erhalten.

Im Menü wählt man das Level aus.
And Yet It Moves
Das Jump'n'Run And Yet It Moves [19]
besticht vor allem durch seine Optik, denn alle Levels sind im
Scherenschnitt gehalten. Bäume sind also beispielsweise nicht
bloß gezeichnet, sondern wirken eher wie aus mehreren Fotos
herausgerissen und zusammengeklebt.
Das Spielprinzip setzt VVVVVV von oben fort, auch wenn man hier nicht
die Gravitation umdreht, sondern die Welt mit den Pfeiltasten
drehen
kann, um zum Ausgang eines Levels zu kommen. In jedem Level gibt
es sehr fair verteilt Speicherpunkte, die einem zugleich die Richtung
weisen, in denen das Level weitergeht. Das ist auch notwendig, denn
wenn man sich bzw. die Welt mehrmals gedreht hat, weiß man nicht mehr,
wo eigentlich oben und unten ist.

Der Schatten weist den Weg.
Spannend wird das Spiel nicht nur, weil man den Ausgang suchen muss,
sondern auch, weil man aufpassen muss, nicht aus zu großer Höhe zu
fallen oder von herabfallenden Steinen erschlagen zu werden. Daneben
versperren auch fleischfressende Pflanzen oder schlafende Gorillas
den Weg.
Erfreulich ist, dass das Spiel ins Deutsche übersetzt wurde, auch
wenn man eigentlich keine große Erklärung benötigt. Der
Schwierigkeitsgrad ist angenehm steigend und somit auch für jüngere
Spieler geeignet. Gestört haben nur die Tonstörungen, die an einigen
Stellen auftauchten.
Auch And Yet It Moves konnte beim Independent Games Festival 2007
als Student Showcase Winner einen Preis erzielen [20].

Die fleischfressende Pflanze lässt einen nicht so einfach vorbei.
Hammerfight
Das aus Russland stammende Hammerfight [21]
ist ein 2-D-Actionspiel, bei
dem man mit einem an einer Flugmaschine
versehenen Hammer durch rhytmische Mausbewegungen diesen zum Schwingen
bringen muss, um dann damit den Gegner zu treffen.
Das Spielprinzip klingt nicht so schlecht, auch wenn es sicher nicht
jedermanns Geschmack ist, der Test schlug nur leider komplett fehl,
weil die Maussteuerung so langsam reagierte, dass man das Fluggerät
nicht kontrolliert bewegen, sondern nur hektisch mit der Maus
fuchteln konnte. Aus dem Grund wurde im Test selbst nach mehreren
Versuchen nicht einmal das erste Level überstanden, sodass sehr
wenig über die Spielentwicklung gesagt werden kann.
Grafisch präsentiert sich das Spiel ganz nett, auch wenn bei
der geringen Auflösung viele Details untergehen.
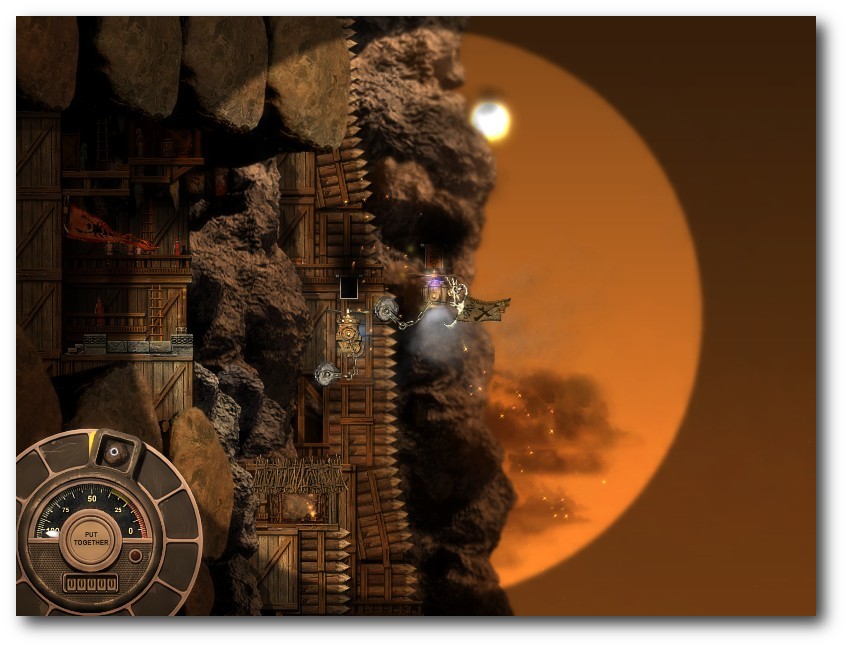
Klopperei mit Hammern.
Fazit
Auch wenn (nach meiner Meinung) mit And Yet It Moves,
VVVVVV und Crayon Physics Deluxe drei sehr gute Spiele im Humble
Indie Bundle enthalten sind, sind die anderen beiden doch nur nettes
Beiwerk. Im Vergleich zu den vorherigen Bundles könnte man fast meinen,
dass die Qualität sinkt, was aber sicher nicht stimmt, denn die
Geschmäcker sind nur verschieden.
Hinweis: Nachdem der Artikel war, wurde zusätzlich noch das Spiel
Steel Storm: Burning Retribution [22]
zum Bundle hinzugefügt.
Dennoch ist natürlich der Selbstbestimmungspreis unschlagbar, sodass
jeder genau das zahlen kann, was er denkt, dass die Spiele wert sind.
Zur Zeit (01.08.2011, 22 Uhr) steht der Verkaufzähler bei 200.000
verkauften Einheiten und Einnahmen in Höhe von über 940.000 US-Dollar.
Wie auch die Bundles zuvor geben die Linux-Nutzer durchschnittlich
das Dreifache eines Windows-Nutzers für den Kauf aus.
Schade ist nur, dass die Spiele nach der Humble-Aktion wohl nicht mehr
verfügbar sein werdenPaket als auf das Spiel selbst,
denn obwohl ein Linux-Port zur
Verfügung steht, bieten die Entwickler nach der Aktion nicht immer einen
Linux-Kauf an, wie die Vergangenheit gezeigt hat. So gibt es
beispielsweise Aquaria, Gish oder Trine nicht als Download
für Linux.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Spiele nicht Open Source sind,
was sich aber gegebenenfalls in der Zukunft ändern kann, wie das auch
beim ersten Humble Indie Bundle der Fall war.
Links
[1] http://www.humblebundle.com/
[2] http://www.deesaster.org/blog/index.php?/archives/1420
[3] http://www.deesaster.org/blog/index.php?/archives/1425
[4] https://www.eff.org/
[5] http://www.childsplaycharity.org/
[6] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2009-03
[7] http://www.bit-blot.com/aquaria/
[8] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-07
[9] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-02
[10] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-07
[11] http://www.deesaster.org/blog/index.php?/archives/1647
[12] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-07
[13] http://www.cogsgame.com/
[14] http://www.igf.com/2010finalistswinners.html#finalists
[15] http://thelettervsixtim.es/
[16] http://www.crayonphysics.com/
[17] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2008-04
[18] http://www.igf.com/2008finalistswinners.html
[19] http://www.andyetitmoves.net/
[20] http://www.igf.com/2007finalistswinners.html#and
[21] http://www.koshutin.com/
[22] http://www.steel-storm.com/
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
spielt sehr gerne unter Linux. Vor allem Geschicklichkeits- und
Denkspiele machen ihm dabei viel Spaß. |
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Sujeevan Vijayakumaran
Eine freie Webanalytik-Software, die in PHP geschrieben ist und
MySQL als Datenbank nutzt, ist Piwik [1]. Mitte
Juni wurde Piwik in Version 1.5 veröffentlicht. Die Software ist
unter der GPL v3 lizenziert und soll eine freie Alternative zu
Google Analytics [2] darstellen.
Allgemeines
Eines der wichtigen Instrumente für einen Webseitenbetreiber ist die
Webanalytik. Durch Webanalytik-Software ist es möglich, das
Verhalten der Webseitenbesucher zu analysieren. Die Software
zeichnet viele Statistiken eines Webseitenbesuchers auf. Neben der
Besuchshäufigkeit und Besuchsdauer der eigenen Webseite wird auch
die IP-Adresse und Herkunft des Benutzers gespeichert.
Die bekannteste Webanalytik-Software kommt aus dem Hause Google.
Google Analytics bietet die umfangreichste Webanalytik auf dem
Markt und ist daher auch sehr weit verbreitet. Der große Nachteil
von Google Analytics ist, dass alle Daten direkt an die
Google-Server übermittelt und auch dort verarbeitet werden. Eine
freie Alternativsoftware wie Piwik ermöglicht ebenfalls eine gute
Webanalytik.
Einen Einblick in die Analysemöglichkeiten von Piwik soll dieser
Artikel geben. Piwik erzeugt aus den gespeicherten Daten sehr viele
Berichte, die in verschiedene Kategorien eingeordnet werden. Die
Daten werden für jeden einzelnen Besucher erhoben, die je nach
Statistik zusammen oder getrennt aufgelistet werden.
Piwik nutzt, wie andere Webanalytik-Software auch, einen
JavaScript-Code zum Aufzeichnen des Verhaltens der
Webseitenbesucher. Der JavaScript-Code muss auf jeder einzelnen
Seite eines Webauftritts eingebunden sein, damit alle Daten
ordnungsgemäß und vollständig erhoben werden können. In den meisten
Content-Management-Systemen lässt sich
dieser Code sehr einfach in
das Template des Footer einbinden. Es wird empfohlen, den Standard
JavaScript-Code zu verwenden, es ist jedoch auch möglich den Code
anzupassen. So lassen sich einige Funktionen ein- bzw. ausschalten.
Eine Alternative für die Benutzer, die JavaScript im Browser
deaktiviert haben, gibt es ebenfalls. Piwik realisiert dieses mit
einen Image Tracker Code, der logischerweise kein JavaScript
verwendet. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass einige wichtige
Funktionen nicht aufgezeichnet werden können. Darunter fallen unter
anderem Suchschlüsselwörter, Browser-Plug-ins und
Bildschirmauflösungen.
Installation und Updates
Die Installation von Piwik lässt sich zügig in etwa fünf Minuten
erledigen und erfolgt ziemlich ähnlich der Installation von
diversen Content-Management-Systemen. Verfügbare Aktualisierungen
erscheinen im Administrationsmenü von Piwik. Diese lassen sich mit
wenigen Klicks direkt im Browser installieren.
Übersicht
Piwik unterteilt die Bedienoberfläche in die Seiten „Besucher“,
„Aktionen“, „Verweise“ und
„Ziele“. Auf jeder Unterseite lassen
sich die Daten der überwachten Webseite für einen speziell
ausgewählten Zeitraum erfassen. So kann man die Statistiken zu
jeden einzelnen Tag, Monat, und Jahr getrennt aufrufen. Neben
diesen vordefinierten Zeiträumen, kann man ebenfalls seinen eigenen
Zeitraum definieren.
Die Übersichtsseite, welche in drei Spalten gegliedert ist, in denen
die wichtigsten Widges liegen, bildet gleichzeitig auch die
Startseite von Piwik. Standardmäßig werden dort unter anderem die
Statistiken zu den letzten Besuchern, Referrer-Webseiten und die
Besucher-Browser angezeigt. Der Administrator kann die Widgets
komplett nach seinen eigenen Belieben anpassen. So ist es möglich,
vorhandene Widgets zu löschen oder neue hinzufügen, außerdem lassen
sie sich per Drag & Drop frei verschieben und neu anordnen.
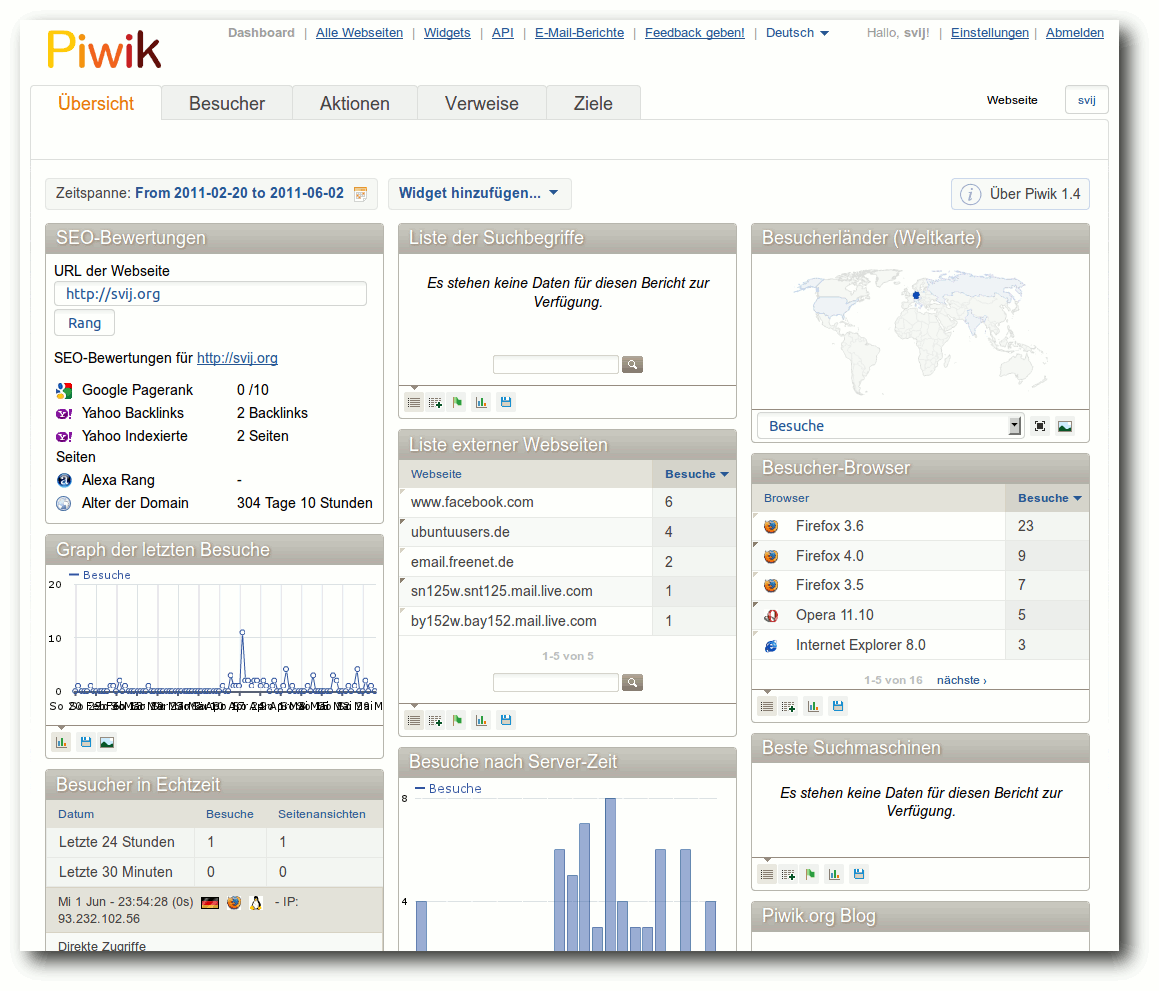
Die Start- und Übersichtsseite von Piwik.
Besucher
Piwik zeichnet sehr viele Informationen zu jedem einzelnen Besucher
auf. Auf der Besucher-Übersichtsseite lässt sich die
Benutzerentwicklung nachvollziehen, des Weiteren werden
Zahlen zur durchschnittlichen Aufenthaltsdauer, Absprungrate der
Benutzer oder auch die Besucheranzahl angezeigt.
Das Besucher-Log zeigt genaue Informationen für jeden Besucher an.
Als Beispiel (siehe Bild) dient hier ein Besucher einer Webseite,
der die Fotogalerie aufgerufen hat. Neben der IP-Adresse, die hier
anonymisiert gespeichert ist,
wird auch die sekundengenaue Uhrzeit
angezeigt, zu der der Besucher die Seite besucht hat. Sofern sich
aus der IP-Adresse der Provider herauslesen lässt, wird auch der
Provider angezeigt, welches in diesem Beispiel Citykom sein soll.
Weiterhin geht aus der Tabelle hervor, dass der Besucher aus
Deutschland kommt, Windows als Betriebssystem verwendet und den
Internet Explorer 9.0 als Browser nutzt. Piwik erkennt an Hand von
einem abgespeicherten Cookie, ob der Besucher die Webseite bereits
besucht hat, oder ob es ein neuer Besucher ist, und markiert dies
in den Statistiken in Form eines Symbols. Ebenso werden die
verwendeten Browser-Plug-ins, wie Flash, PDF, Java oder Quicktime,
erfasst und ausgewertet. Einzig die Plug-ins
von Besuchern, die den
Internet Explorer verwenden, werden, wie hier im Beispiel, nicht
gespeichert. Nur die Verwendung von Java wird ausgegeben. Weitere
Informationen etwa über die Version des Betriebssystems, der
verwendeten Version des Browsers und der genutzten Auflösung wird
in einem Mouse-Over über den dazugehörenden Symbolen angezeigt.
Darüber hinaus merkt sich Piwik auch die Herkunft des Besuchers,
sofern die Referrer-Seite ermittelt werden konnte, ansonsten zeigt
Piwik an, dass der Besucher direkt auf die Seite zugegriffen hat.
Ergänzend ist es mit Piwik auch möglich zu sehen, was der Besucher
genau auf der Webseite getan, welche Unterseiten er besucht,
und wie lange er sich insgesamt auf der gesamten Webseite
aufgehalten hat. Zudem werden Downloads, beispielsweise von
Bildern, aufgezeichnet.
Die weiteren Unterkategorien von „Besucher“ fassen einzelne
Informationen thematisch zusammen. Unter „Standorte und Provider“
werden Graphen und Zahlen von Besuchern sortiert in Kontinente,
Länder und Provider dargestellt. Im weiteren Punkt „Einstellungen“
werden die verwendeten Browser und Plug-ins aufgelistet, als auch
die Betriebssysteme und die Bildschirmauflösungen. Das
Datenmaterial wird teilweise in Kreisdiagrammen angezeigt, aber
auch in Listen mit absoluten Werten und stellenweise Prozentwerten.
Der Anwender
kann nach eigenen Belieben zwischen den verschiedenen
Ausgabeoptionen wie Tabellen und Diagrammen wechseln.
Neben diesen Informationen werden, wie bereits erwähnt, auch die
Verweilzeiten gespeichert, die ebenfalls nochmal getrennt in einem
Diagramm visualisiert sind. In der Unterkategorie „Engagement“
wird unter anderem die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der
Webseite dargestellt sowie die Menge der wiederkehrenden
Besucher.
Nützlich sind besonders die zahlreichen Exportoptionen von Piwik.
Sie ermöglicht das Exportieren eines Datensatzes als CSV, TSV, XML
als auch in Json, PHP und RSS.
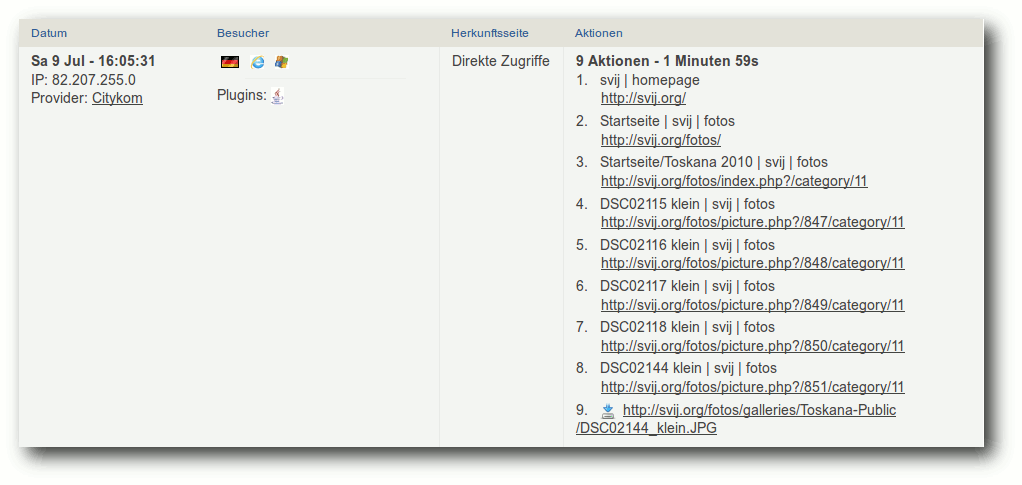
Die gespeicherten Informationen zu einem eindeutigen Besucher.
Aktionen
In die Kategorie „Aktionen“ fallen alle Daten über die einzelnen
Seiten. Unterteilt wird die Kategorie in „Seiten“,
„Eingangsseiten“, „Ausstiegsseiten“, „Seitentitel“, „Ausgehende Verweise“
und „Downloads“. In der Unterkategorie „Seiten“ wird
unter anderem dargestellt, welcher Teil der Webseite die meisten
Seitenansichten hat, wie hoch die Absprung- und Ausstiegsrate ist,
aber auch die durchschnittliche Verweildauer auf der Seite. In
„Eingangs- und Ausstiegsseiten“ wird nun differenziert dargestellt,
welche Einzelseite die Besucher zuerst öffnen, und wiederum bei
welcher Einzelseite sie die Webseite verlassen haben. Während bei
„Seiten“ die Daten nach der Struktur und den Dateinamen einzelnen
Seiten geordnet sind, werden bei „Seitentitel“ die Titel der
Einzelseiten aufgezählt und mit den gleichen Fakten veranschaulicht.
Mit den aufgezeichneten Daten unter „Ausgehende Verweise“ kann der
Webseitenbetreiber leicht erkennen, über welche Links die Besucher am
häufigsten die Seite verlassen. Der letzte Unterpunkt unter
„Aktionen“ ist der Bereich „Downloads“. Dort wird ziemlich simpel
aufgelistet, welches Datenmaterial und wie oft heruntergeladen wurde.
Verweise
Die Kategorie „Verweise“ wertet hauptsächlich die Herkunft der
Besucher aus. Unterteilt in „Suchmaschinen und Suchbegriffe“
sammelt Piwik die Anzahl der Besuche unterteilt nach den
verschiedenen Suchmaschinen. Zusätzlich wird erfasst,
welche Suchbegriffe die Besucher verwendet haben, um auf die
Webseite zu gelangen.
Neben der Herkunft der Besucher von
Suchmaschinen kommen diese ebenfalls von anderen Webseiten. Unter
„Webseiten“ wird hier aufgezählt, welche Seiten in besonderem Maße
die Besucher auf die eigene Seite weiterleiten.
Ziele
Eigene Statistiken lassen sich unter „Ziele“ erstellen. Der
Webseitenbetreiber kann so beispielsweise ein Ziel für
Registrierung von neuen Benutzern erstellen oder die Aufrufanzahl
von „Bitte Lesen“-Posts verfolgen.
Weiteres
Piwik bietet neben dem Webauftritt auch die Möglichkeit der
E-Mail-Benachrichtigung an. Die Berichte lassen sich individuell
gestalten und an mehrere Leute senden. Die einzelnen Datensätze
lassen sich aktivieren und deaktivieren. So ist es möglich, nur
Teile der Daten an weitere Personen zu senden, während der
Administrator selbst eine E-Mail mit vollständigen Datensätzen
bekommt.
Eigene Funktionen lassen sich mit Hilfe der API realisieren. Die
bereits enthaltenen Funktionen sind als Plug-ins in Piwik
eingebunden. In den Plug-in-Einstellungen ist es möglich, einige der
Funktionen ab- und anzuschalten, sodass nicht alles gespeichert
wird.
Datenschutz
Ein Punkt, den man bei der Webanalytik nicht außer Acht lassen darf,
ist der Datenschutz. Problematisch ist hierbei die Erfassung
personenspezifischer Daten wie beispielsweise die IP-Adresse, mit der
eine eindeutige Identifizierung (mehr oder weniger) möglich ist.
(Es ist von deutschen Gerichten aber immer noch nicht einstimmig
geklärt, ob die IP-Adresse wirklich ein personenbezogenes Datum ist
oder nicht [3].)
Piwik arbeitet aus diesem Grund mit dem Unabhängigen Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)
zusammen [4].
Die angeregten Verbesserungen wurden bereits in der Version 1.2
eingepflegt. Das ULD hat ein Dokument veröffentlicht [5],
in welchem angegeben wird, wie man Piwik datenschutzrechtlich
einwandfrei nutzen kann. Darunter fallen unter anderem die
Anonymisation von IP-Adressen als auch die Opt-Out-Funktion, die es
ermöglicht, die Besucher entscheiden zu lassen, ob Piwik seine
Daten speichern darf oder nicht. Standardmäßig werden die Daten
jedoch automatisch gespeichert. Der Administrator hat die
Möglichkeit, mittels eines iframes dem Besucher die Möglichkeit zu
geben, der Speicherung seiner Daten zu widersprechen. Durch die
Deaktivierung seitens des Besuchers wird dann der eindeutige
Webanalyse-Cookie deaktiviert.
Piwik Mobile
Eine Mobil-Seite für den Abruf der Statistiken von einem Smartphone
oder Tablet gibt es bisher nicht. Stattdessen gibt es eine
offizielle und kostenlose App unter dem Namen „Piwik Mobile“ für
Android [6] und
iOS [7],
welches ebenfalls unter der GPL lizenziert ist.
Die App bietet ziemlich den gleichen Funktionsumfang wie auch
die eigentliche Webseite an sich. Die einzelnen
Statistiken sind in Gruppen zusammengefasst und in einer Liste
geordnet. Jeder Unterpunkt der gesammelten
Informationen wird in einem Kreisdiagramm dargestellt, des Weiteren
werden die absoluten Zahlen
in einer Tabelle angezeigt. In der
oberen Leiste gibt es neben der Möglichkeit, den Zeitraum
individuell umzustellen und somit eine veränderte Statistik
abzurufen, auch noch die Möglichkeit, zwischen mehreren
Piwik-Datenbanken zu wechseln.
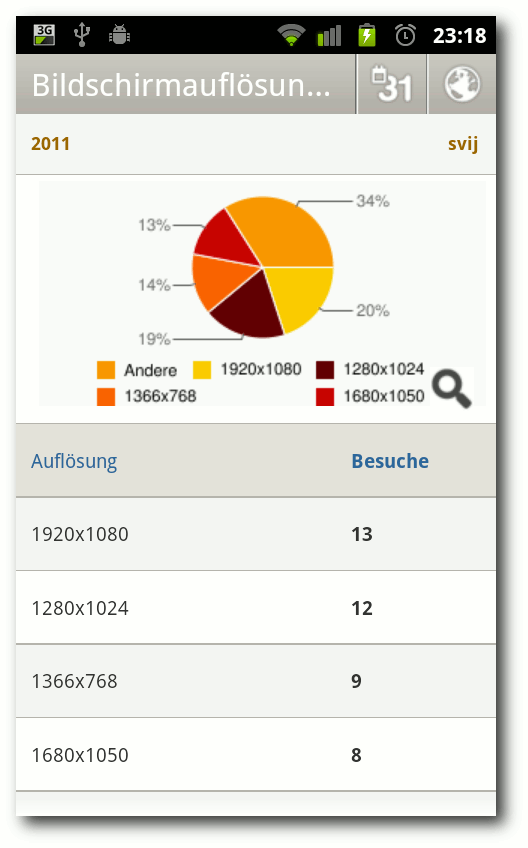
Statistik zu Bildschirmauflösungen im Android-App.
Geschichte von Piwik
Piwik entstand auf der Grundlage von
phpMyVisites [8]. Nach der Einstellung
des Projekts phpMyVisites wurde daraus Piwik. Die Version 0.1 wurde im
März 2009 veröffentlicht und seitdem stetig weiterentwickelt.
August 2010 erschien Piwik in Version 1.0, danach folgten zügig
weitere Veröffentlichungen. Die aktuelle Version 1.5 wurde Mitte
Juni veröffentlicht. Piwik wurde mittlerweile über 675.000 mal
heruntergeladen [9] und wird von
zahlreichen Webseitenbetreibern genutzt.
Neues in Piwik 1.5
Mit der neuen Version von Piwik kamen, neben Fehlerkorrekturen und
weiteren kleineren Änderungen, auch neue Funktionen. Als neue
Funktion wurde unter anderem
E-commerce [10] und
benutzerdefinierte Variablen [11]
eingeführt. Des Weiteren wurde die Nutzung von Flash für die Anzeige
von Graphen abgeschafft [12]
Die Graphen werden nun mittels einer Kombination aus Canvas und
JavaScript erzeugt. Einzig für die Weltkarte der Besucher wird noch
Flash benötigt.
Ausblick
Nach der Roadmap [13] ist es die Mission
von Piwik eine führende Open-Source-Webanalytik-Software zu
entwickeln, die den Zugang zur gesamten Funktionalität durch
offene APIs und offenen Komponenten gewährleisten soll. Unter
anderem ist geplant, dass man benutzerdefinierte Benachrichtigungen
auf Aktionen erstellt, sodass der Administrator jedes Mal via
E-Mail benachrichtigt wird, wenn dieser Fall eintritt. Des Weiteren
soll die Länder- und Städte-Lokalisation mittels der
GeoIP-Datenbank eingebunden werden. Alle weiteren Funktionen, die
bis zur Version 2.0 eingefügt werden sollen, können in
der Roadmap nachgelesen werden.
Links
[1] http://de.piwik.org/
[2] http://www.google.de/analytics/
[3] http://www.internet-law.de/2011/06/datenschutz-ip-adressen-als-personenbezogene-daten.html
[4] http://de.piwik.org/blog/2011/03/unabhangiges-landeszentrum-datenschutz-uld-piwik-datenschutzkonform-einsetzbar/
[5] https://www.datenschutzzentrum.de/tracking/piwik/
[6] https://market.android.com/details?id=org.piwik.mobile
[7] http://itunes.apple.com/us/app/piwikmobile/id385536442?mt=8
[8] http://www.phpmyvisites.us/
[9] http://piwik.org/download/counter/
[10] http://piwik.org/docs/ecommerce-analytics/
[11] http://piwik.org/docs/custom-variables/
[12] http://piwik.org/blog/2011/06/piwik-innovative-with-javascript-canvas-chart-and-contributing-by-jqplot-creator/
[13] http://piwik.org/roadmap/
| Autoreninformation |
| Sujeevan Vijayakumaran (Webseite)
testet gerne verschiedene Content-Management-System und setzt Piwik
auch auf seiner eigenen Homepage ein.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Hans-Joachim Baader
Überraschenderweise ist auch vier Jahre nach dem Start der
LPIC-3-Zertifizierung das Buchangebot dazu sehr übersichtlich. Mit
„LPI 301“ stößt der IT-Trainer Thorsten Robers in diese Lücke vor.
Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „LPI 301“ erschien erstmals bei
Pro-Linux [1].
Vorwort
Das Linux Professional Institute (LPI) [2]
bietet umfassende Linux-Zertifizierungsprogramme in bisher drei
Stufen an. Die Besonderheit der Zertifizierungen des LPI ist, dass
sie in Gemeinschaftsarbeit interessierter Freiwilliger entwickelt
werden und hersteller- sowie distributionsunabhängig sind.
Nach den Stufen LPIC-1 („Junior Level Linux Professional“) und
LPIC-2 („Advanced Level Linux Professional“), die jeweils zwei
Prüfungen umfassen, bietet LPI seit 2007 auch als dritte Stufe
LPIC-3 („Senior Level Linux Professional“) als bisher
anspruchsvollste Zertifizierung an.
LPIC-3 [3]
wird anders als die ersten beiden Stufen mit nur einer einzigen
Prüfung erworben, die wahlweise durch zusätzliche Prüfungen ergänzt
werden kann. Die verpflichtende Prüfung 301 nennt sich „Core“.
Inzwischen stehen als Spezialisierungs-Prüfungen „Mixed
Environments“ (302), „Security“ (303), „Virtualization and High
Availability“ (304, momentan Betaversion) zur Verfügung.
Da die Stufen aufeinander aufbauen, kann man die Zertifizierung als
LPIC-3 erst erhalten, wenn man diejenigen für LPIC-2 und LPIC-1
absolviert hat. Die Prüfungen umfassen Multiple-Choice- und frei
auszufüllende Fragen. LPIC-3 macht hier keine Ausnahme. Ablegen
kann man die Prüfungen in einem Prüfungszentrum, das in der Regel
von einem Unternehmen betrieben wird. Weltweit stehen einige
tausend Zentren zur Verfügung.
Trotz der über vier Jahre, die die Prüfung 301 bereits existiert,
sind Prüfungsunterlagen kaum zu finden. „LPI 301“ ist
das erste deutschsprachige Buch zu der Prüfung und auch
weltweit eines der ersten, wenn nicht gar das einzige.
Die Prüfung 301 umfasst laut Beschreibung die Themen
Authentifikation, Problemlösung, Netzwerk-Integration und
Kapazitätsplanung. In der Praxis bedeutet dies fast ausschließlich
LDAP.
Das Buch
Das vorliegende Buch widmet sich ausschließlich der Vorbereitung auf
die Prüfung 301. Wie bereits erwähnt geht es in dieser Prüfung
vorwiegend um LDAP. Es sei aber betont, dass „LPI 301“ deswegen
trotzdem kein LDAP-Lehrbuch ist. Wenn es so wäre, hätte es wohl den
Begriff „LDAP“ im Titel. Zur Vorbereitung auf die Prüfung 301 ist
nicht unbedingt ein Buch über LDAP notwendig, umfassende Kenntnisse
von OpenLDAP sind aber unerlässlich.
Zur Not genügt hierfür aber
auch die Online-Dokumentation von
OpenLDAP [4] einschließlich der FAQs
sowie praktisches Arbeiten an einem selbst aufgesetzten Server.
Das Buch des erfahrenen Systemadministrators und IT-Trainers
Thorsten Robers orientiert sich in seiner Kapitelstruktur an den
detaillierten Lernzielen [5] der
Prüfung 301. Nach einem kurzen Vorwort von nur drei Seiten beginnt
sofort die Vorstellung und Behandlung der Prüfungsinhalte in sechs
Kapiteln. Dabei werden keinerlei konkrete Prüfungsfragen
vorgestellt. Es ist also leider nicht möglich, eine Testprüfung mit
einigermaßen realistischen Fragen zu absolvieren. Entsprechende
Fragen, die zwar nicht identisch, aber ähnlich zu den tatsächlich
in der Prüfung vorkommenden Fragen sind, findet man eventuell bei
anderen Anbietern oder im Web, allerdings ist mir derzeit keine
konkrete Quelle bekannt. Stattdessen profitieren die Leser von der
Erfahrung des Autors, der die Prüfung bereits kennt und daher
Angaben machen kann, worauf man sich besonders vorbereiten muss.
Die Kapitel sind nicht ab 1 fortlaufend nummeriert, sondern von 301 bis 306,
was den so nummerierten Themengebieten der Prüfung entspricht. Alle sechs
Kapitel sind in Unterkapitel gegliedert, die alle den gleichen Aufbau
besitzen. Am Anfang steht jeweils eine kurze Übersicht mit der Gewichtung (1-5),
Beschreibung und einem Satz, wichtigen Wissensgebieten und wichtigen
Dateien, Begriffen und Hilfsprogrammen. Diese Information ist mehr oder
weniger direkt den Prüfungszielen entnommen. Danach bietet jedes Kapitel
eine umfassende Erläuterung zu den Themen und Aufgaben. Es gibt Beispiele
zur Konfiguration und Verwendung der Programme, Hinweise auf besonders
beachtenswerte Sachverhalte und Hinweise, was für die Prüfung relevant ist.
An manchen Stellen finden sich darüber hinausgehende Hinweise. Jedes Kapitel
wird mit einem kurzen Abschnitt abgeschlossen, der nochmals darauf hinweist,
was zur Vorbereitung auf die Prüfung zu beherrschen ist.
Kapitel 301 „Konzepte, Architektur und Design“ beschäftigt sich mit
LDAP-Konzepten und -Architektur, dem Entwerfen eines
LDAP-Verzeichnisbaums und Schemata. Kapitel 302 „Installation und
Entwicklung“ besitzt nur zwei Unterkapitel, das Kompilieren und
Installieren von OpenLDAP und die Softwareentwicklung für LDAP
unter Perl oder C++. Letzteres kann man notfalls auch
vernachlässigen.
Kapitel 303 „Konfiguration“ weist Unterkapitel zu ACLs in LDAP,
LDAP-Replikation, Absicherung des LDAP-Verzeichnisses,
Performance-Tuning des LDAP-Servers und Konfiguration des
OpenLDAP-Daemons auf. Das nächste Kapitel 304 „Bedienung“
beschreibt das Durchsuchen des Verzeichnisses,
LDAP-Kommandozeilenwerkzeuge und Whitepages. Während man in der
Praxis meist mit grafischen Oberflächen arbeitet, wenn es nicht
gerade um Massenoperationen geht, ist dieser Teil für die Prüfung
ziemlich wichtig, da sie sich auf die Kommandozeilenwerkzeuge
beschränkt.
Kapitel 305 „Integration und Migration“ ist das letzte Kapitel zum
Thema LDAP. Themen sind die LDAP-Integration mit PAM und NSS,
Migration von NIS nach LDAP, Integration von LDAP und Unix-Dienste,
Integration von LDAP mit Samba, Integration von LDAP mit Active
Directory und Integration von LDAP mit E-Mail-Diensten. Es folgt
ein abschließendes Kapitel 306 „Kapazitätsplanung“, das einzige
Thema, das nichts mit LDAP zu tun hat. Die Themen Messen des
Ressourcenverbrauchs, Fehlerbehebung bei Ressourcenproblemen,
Analyse der Leistungsanforderungen und Vorhersagen zukünftigen
Ressourcenverbrauchs dürften keinem erfahrenen Linux-Administrator
Probleme bereiten.
Ein Anhang und ein nützliches Inhaltsverzeichnis runden das Buch ab.
Einige Schreib- und Satzfehler erwecken den Eindruck, dass das Buch
schnell fertiggestellt werden musste. Fachliche Fehler sind
allerdings nicht zu entdecken.
Fazit
„LPI 301“ eignet sich hervorragend zum Sebststudium und ist allen zu
empfehlen, die sich auf die Prüfung LPI 301 vorbereiten wollen. Ob
man es unbedingt benötigt, hängt sicher von der individuellen
Arbeitsweise ab. Die Investition ist aber wesentlich günstiger als
eine Wiederholung der Prüfung, falls man es beim ersten Mal nicht
schaffen sollte, da LPI 301 mit 250 US-Dollar zu Buche schlägt.
Andere professionelle Schulungsunterlagen, soweit überhaupt auf
Deutsch verfügbar, sind deutlich teurer und eine mehrtägige
Schulung ist noch einmal eine ganz andere Kategorie.
| Buchinformationen |
| Titel | LPI 301 |
| Autor | Thorsten Robers |
| Verlag | Open Source Press |
| Umfang | 343 Seiten |
| ISBN | 978-3-941841-36-9 |
| Preis | 34,90 EUR |
| |
Links
[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1513/lpi-301.html
[2] http://www.lpi.org/
[3] http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_3
[4] http://www.openldap.org/
[5] http://www.lpice.eu/de/lpi-zertifizierungsinhalte.html
| Autoreninformation |
| Hans-Joachim Baader (Webseite)
befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss
er sein Informatikstudium erfolgreich ab, machte die
Softwareentwicklung zum Beruf und ist einer der Betreiber
von Pro-Linux.de.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Sie kennen eine Linux-Messe, welche noch nicht auf der Liste zu
finden ist? Dann schreiben Sie eine E-Mail mit den Informationen zu
Datum und Ort an .
Zum Index
.
Zum Index
freiesMagazin erscheint immer am ersten Sonntag eines Monats. Die September-Ausgabe wird voraussichtlich am 4. September unter anderem mit folgenden Themen veröffentlicht:
- Trinity – Desktop ohne Zukunft
Es kann leider vorkommen, dass wir aus internen Gründen angekündigte Artikel verschieben müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Zum Index
An einigen Stellen benutzen wir Sonderzeichen mit einer bestimmten
Bedeutung. Diese sind hier zusammengefasst:
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können
hier auch einfach in einer normalen Shell ein
sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis
/home/BENUTZERNAME |
Zum Index
|
| Erscheinungsdatum: 7. August 2011 |
|
|
| Redaktion |
| Frank Brungräber | Thorsten Schmidt |
| Dominik Wagenführ (Verantwortlicher Redakteur) |
| |
| Satz und Layout |
| Ralf Damaschke | Nico Maikowski |
| Matthias Sitte | |
| |
| Korrektur |
| Daniel Braun | Stefan Fangmeier |
| Mathias Menzer | Karsten Schuldt |
| Stephan Walter | |
| |
| Veranstaltungen |
| Ronny Fischer |
| |
| Logo-Design |
| Arne Weinberg (GNU FDL) |
| |
Dieses Magazin wurde mit LaTeX erstellt. Mit vollem Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung
der Redaktion wieder. Wenn Sie
freiesMagazin ausdrucken möchten, dann
denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die
Bäume werden es Ihnen danken. ;-)
Soweit nicht anders angegeben, stehen alle Artikel, Beiträge und Bilder in
freiesMagazin unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported. Das Copyright liegt
beim jeweiligen Autor.
freiesMagazin unterliegt als Gesamtwerk ebenso
der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported mit Ausnahme der
Inhalte, die unter einer anderen Lizenz hierin veröffentlicht
werden. Das Copyright liegt bei Dominik Wagenführ. Es wird erlaubt,
das Werk/die Werke unter den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz
zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren. Das
freiesMagazin-Logo
wurde von Arne Weinberg erstellt und unterliegt der
GFDL.
Die xkcd-Comics stehen separat unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-NC 2.5 Generic. Das Copyright liegt
bei
Randall Munroe.
Zum Index
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.89.
On 20 Aug 2011, 16:46.